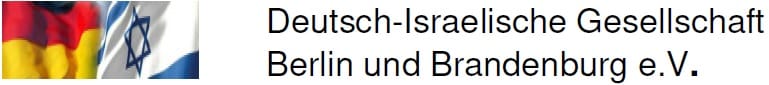Mit freundlicher Genehmigung des Autors veröffentlichen wir im Folgenden den Vortrag von Alex Feuerherdt. Er ist freier Autor und lebt in Bonn. Feuerherdt schreibt regelmäßig für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften zum Thema Nahost, unter anderem für die Jüdische Allgemeine, Konkret, den Tagesspiegel und die Jungle World.
TENNIS (I): VERWEIGERTE EINREISE
Als sowohl der finanzielle als auch der Imageschaden bereits beträchtlich war und die Zukunft des internationalen Tennisturniers in Dubai außerdem in Frage stand, gaben dessen Organisatoren sowie die Behörden der Vereinigten Arabischen Emirate schließlich nach: Der israelische Tennisprofi Andy Ram erhielt doch noch ein Visum und konnte Ende Februar dieses Jahres bei den Dubai Open an den Start gehen. Seiner Landsfrau Shahar Pe’er war zuvor die Einreise in den Golfstaat verweigert worden. Die offizielle Begründung der Veranstalter vor Ort für diese Entscheidung lautete: „Wir wollen den Sport nicht politisieren, aber wir müssen nach den Vorgängen in der Region sensibel sein.“ Der Gaza-Krieg bewege, so hieß es, „nach wie vor viele Menschen im Nahen Osten“. Deshalb habe Grund zu der Annahme bestanden, dass die Teilnahme der Spielerin aus dem jüdischen Staat die Fans „aufgebracht hätte“. Die Organisatoren sorgten also nicht etwa für den Schutz der Filzballkünstlerin, wie es sich gehört hätte, sondern sperrten sie stattdessen aus – einzig und allein aus dem Grund, dass sie Israelin ist. Man betrachtete Shahar Pe’er ganz selbstverständlich als politische Repräsentantin, ja, als Handlangerin des israelischen Staates und fragte noch nicht einmal danach, wie sie überhaupt zu dessen Politik steht. Damit will ich selbstverständlich kein Plädoyer für eine solche Gesinnungsprüfung halten, sondern vielmehr deutlich machen, welcher Denklogik hinter dem Einreiseverbot stand. Doch zu dieser Art von Logik später mehr.
Die Entscheidung, Shahar Pe’er kein Visum zu gewähren und damit einen Boykott gegen sie zu verhängen, stieß übrigens auf heftige Kritik. Die Weltranglisten-Sechste Venus Williams beispielsweise sagte: „Alle Spielerinnen unterstützen Shahar.“ Larry Scott, der Chef der Profiorganisation der Tennisspielerinnen (WTA), schloss sich an: „Wir haben klare Regeln und eine eindeutige Politik, dass kein gastgebendes Land einem Spieler das Recht verweigern darf, an einem Turnier teilzunehmen, für das er qualifiziert ist“, sagte er. Die internationale Menschenrechtsorganisation Simon-Wiesenthal-Center forderte sogar den Abbruch der Veranstaltung und erklärte: „Wenn man Israelis aussperrt, kann man das Turnier auch gleich Dubai Apartheid Open nennen.“ Die WTA belegte die Organisatoren schließlich mit einer Strafe von 300.000 Dollar – der höchsten Geldbuße, die sie jemals gegen eines ihrer Mitglieder verhängt hat. Darüber hinaus nannte die WTA Bedingungen dafür, dass das Turnier in Dubai auch im kommenden Jahr in den Kalender aufgenommen wird. Die Organisatoren in den Emiraten müssen Pe’er für 2010 eine Wildcard – also eine automatische Startberechtigung – gewähren und sich ver¬pflichten, sämtliche qualifizierten Spielerinnen und Spieler auch tatsächlich zur Veranstaltung zuzulassen. Allen israelischen Tennisprofis muss zudem mindestens acht Wochen vor den Wettkämpfen die Einreise garantiert sein. „Wir werden nicht erlauben, dass sich diese Situation wiederholt – weder in den Vereinigten Arabischen Emiraten noch irgendwo anders auf der Welt“, sagte WTA-Boss Scott.
Zuvor hatten bereits der amerikanische Tennis Channel und die Europa-Ausgabe des Wall Street Journal Konsequenzen gezogen: Der Fernsehsender brach die Übertragung ab, und die Zeitung, ein wichtiger Sponsor des Turniers, zog ihre finanziellen Zusagen zurück. Nicht minder schwer dürfte die Veranstalter der Rückzug des Titelverteidigers bei den Männern, Andy Roddick, getroffen haben. Während es Pe’ers Kolleginnen bei mündlichen Solidaritätsadressen beließen und das Turnier in Dubai zu Ende spielten, sagte Roddick seine Teilnahme an den Wettkämpfen aus Protest ab.
TENNIS (II): „EIN MATCH GEGEN DEN STAAT ISRAEL“
Die Einreiseverweigerung für Shahar Pe’er blieb nicht die einzige antiisraelische Boykottaktivität im Tennis zu Beginn dieses Jahres. Auch das Tennis-Davis-Cup-Spiel zwischen Schweden und Israel in Malmö Anfang März war davon betroffen. Wochenlang hatte ein politisches Bündnis namens Stoppa Matchen (übersetzt: „Stoppt das Match“) alles daran gesetzt, die Begegnung zu verhindern. Zu den Unterstützern von Stoppa Matchen zählten die Anführer der Linkspartei, die Sozialdemokraten, der Sozialdemokratische Frauenbund, die Sozialisten und die Kommunistische Partei. Ein Teil dieser Parteien gehört der linken Mehrheit im Malmöer Stadtrat an.
Und diese linke Mehrheit erklärte, man werde aus Angst vor Ausschreitungen die Davis-Cup-Spiele unter Ausschluss des Publikums durchführen. Das Sicherheitsrisiko sei viel zu groß, denn man könne die Sicherheit der israelischen Spieler nicht garantieren, lautete die scheinheilige Begründung. Ilmar Reepalu, sozialdemokratischer Stadtratsvorsitzender, gab einen Einblick in die eigentlichen Gründe für den Ratsbeschluss: „Meiner Meinung nach sollte man generell überhaupt nicht gegen Israel spielen“, sagte er der Tageszeitung Sydsvenskan und nannte die israelische Intervention in Gaza als Grund. Die Davis-Cup-Partie sei eine „Provokation für die in Malmö lebenden Araber“ und daher „kein gewöhnliches Match“, sondern „ein Match gegen den Staat Israel“.
Das heißt also: Als antiisraelische Demonstranten hätten die linken Stadträte das Tennisspiel am liebsten ganz verhindert, also boykottiert; als linke Stadträte haben die antiisraelischen Demonstranten dann zumindest durchgesetzt, dass die Davis-Cup-Begegnung zwischen den schwedischen und den israelischen Tennisspielern ohne Zuschauer über die Bühne gehen muss. Dabei hatte Håkan Jarborg Eriksson, der für das Match verantwortliche Einsatzleiter der Malmöer Polizei, gar keinen Grund gesehen, das Publikum auszusperren. In einem Interview hatte er deutlich gemacht: „Es hat auch früher schon geklappt, Einlasskontrollen und Kartenvorverkauf sicher zu handhaben, wenn man verhindern wollte, dass es in der Arena zu Unruhen kommt.“
Der schwedische Tennisverband sowie Politiker der konservativen und liberalen Parteien kritisierten das Vorhaben, vor leeren Rängen zu spielen, und die Tiraden gegen Israel als „völlig überzogen“. Die Vorsitzende des schwedischen Sportverbands, Karin Mattsson Weijber, sprach von einem „inakzeptablen Beschluss“. Das von einer konservativen Mehrheit regierte Stockholm erklärte seine grundsätzliche Bereitschaft, das Spiel in der Hauptstadt stattfinden zu lassen, sagte aber schließlich doch wieder ab: Die Vorbereitungszeit sei zu knapp. Der Tennis-Weltverband ITF zog es vor, zu der Angelegenheit zu schweigen.
Dutzende antiisraelische Aktivisten lieferten sich dann am ersten Tag der zweitägigen Davis-Cup-Begegnung Straßenschlachten mit der Polizei beim Versuch, die verschlossene Halle zu stürmen, in der das Spiel stattfand. Die Demonstranten warfen Steine und Feuerwerkskörper auf Polizeiwagen, als sie die Absperrungen durchbrechen wollten, durch die sie von der Halle fern gehalten werden sollten. Hunderte Bereitschaftspolizisten drängten die Menge mit Hilfe von Schlagstöcken zurück. Berichten zufolge gab es keine Verletzten; fünf Personen sind laut Polizeiangaben jedoch festgenommen worden. Die Ausschreitungen brachen im Anschluss an eine Demonstration aus, die im Stadtzentrum von Malmö stattgefunden hatte. 7.000 Menschen hatten sich dort versammelt, um Reden zu hören, in denen Israels Vorgehen im Gazastreifen verurteilt und die Unterstützung der Palästinenser gefordert wurde.
Die Organisatoren hatten eine so genannte friedliche Demonstration angekündigt, doch linksradikale Aktivisten wollten das Tennisspiel unbedingt sprengen. Einige Demonstrationsteilnehmer marschierten schließlich auf die Halle zu und griffen dort die Polizei an. Die Partie zwischen Schweden und Israel begannen dennoch wie geplant vor rund 300 ausgewählten Gästen, die von den beiden Tennisverbänden eingeladen worden waren. Und die israelischen Tennisprofis gaben die Antwort auf die Anfeindungen auf dem Platz: Sie gewannen das Match mit 3:2 und brachten ihre Farben erstmals seit 1987 wieder ins Daviscup-Viertelfinale. Der israelische Tennisspieler Harel Levy bemerkte anschließend trocken: „Womöglich haben die Schweden dieses Spiel verloren, weil ihnen die Unterstützung der Zuschauer fehlte. Die Umstände haben sie stärker beeinträchtigt als uns. Hoffentlich passiert so etwas nicht noch einmal.“
BASKETBALL: KRAWALLE IN ANKARA
Das waren die beiden jüngsten Beispiele für Boykotte respektive Boykottaufrufe gegen israelische Sportler. Einmal ging die Initiative dabei von den Veranstaltern eines Tennisturniers aus, einmal von antiisraelischen Lokalpolitikern und Aktivisten. Zu Beginn dieses Jahres gab es aber noch einen weiteren Vorfall, und der ging auf das Konto des Publikums: Bei einem Europapokalspiel im Basketball zwischen Turk Telekom Ankara und der israelischen Mannschaft Bnei Hasharon im Januar verhinderten randalierende Zuschauer eine Austragung der Partie. Rund 3.000 türkische Anhänger riefen antiisraelische Parolen, bewarfen die israelischen Basketballer mit Feuerzeugen, Schuhen sowie Wasserflaschen und verbrannten israelische Fahnen. Die Sicherheitskräfte konnten nur mit Mühe verhindern, dass der Platz gestürmt wird. Sie räumten schließlich die Halle, vor der es zu weiteren Ausschreitungen kam. Die Spieler von Bnei Hasharon flüchteten unter Polizeischutz in die Kabine. Die Schiedsrichter wollten schließlich vor leeren Rängen die Partie beginnen, doch die Israelis verweigerten sich diesem Ansinnen. Turk Telekom Ankara wurde später zwar mit einer Geldstrafe belegt; das Spiel jedoch wertete der internationale Basketballverband FIBA mit 20:0 gegen den israelischen Klub. Für Bnei Hasharons Vorsitzenden Eldad Akunis war diese Entscheidung ein Skandal: „Nach so einer nervenaufreibenden Tortur konnte man einfach nicht mehr spielen“, sagte er. „Die Spieler hatten Sorgen um ihre Sicherheit.“
ISRAEL IM FUSSBALL: BOYKOTTIERT, BEHINDERT, BENACHTEILIGT
Nicht nur in diesem Fall traf ein Sportverband eine mehr als fragwürdige Entscheidung, mit der israelische Sportler, gegen die sich antiisraelische Ressentiments entluden, auch noch bestraft wurden. Weitere und ältere Beispiele für Sportboykotte gegen Israel und für Benachteiligungen israelischer Sportler und Mannschaften finden sich vor allem im Fußball. Auf einige davon möchte ich nun etwas näher eingehen.
Vorab eine ganz kurze geschichtliche Einführung: Gegründet wurde der israelische Fußballverband, die IFA (Israeli Football Association), kurz nach der Staatwerdung Israels im Jahre 1948. Das erste Länderspiel bestritt das israelische Team am 26. September 1948 vor 40.000 Zuschauern in New York gegen die USA. Es ging mit 1:3 verloren, aber das war angesichts der historischen Bedeutung dieses Ereignisses vollkommen nebensächlich. Schon vor der Staatsgründung gab es einen nationalen Fußballverband, der vor allem von jüdischen Siedlern und der britischen Mandatsmacht etabliert und 1929 in den Weltfußballverband FIFA aufgenommen worden war. Unter der Bezeichnung Palästina nahm er 1934 und 1938 an den Qualifikationsspielen zur Fußball- Weltmeisterschaft teil, jedoch ohne Erfolg: 1934 gingen die beiden Partien gegen Ägypten mit 1:7 und 1:4 verloren; vier Jahre später schied man mit 1:3 und 0:1 gegen Griechenland aus.
Die erste Weltmeisterschaftsqualifikation, für die Israel sich meldete, war die für das Turnier 1950 in Brasilien. Angesichts der Vernichtungsdrohungen der arabischen Staaten hielt der Weltfußballverband FIFA es für ratsam, die Auswahl des jüdischen Staates in der Qualifikation gegen ein europäisches Team antreten zu lassen. Gegen Jugoslawien verlor Israel mit 0:6 und 2:5 und schied aus. Besser sah es da schon vier Jahre später aus: Gegen Griechenland gelangen zunächst zwei Siege, bevor erneut Jugoslawien Endstation war, diesmal jedoch nur mit zwei 0:1-Niederlagen.
1956 trat der israelische Verband der Asiatischen Fußball-Konföderation (AFC) bei, in deren geografischem Einzugsbereich das Land nun einmal liegt. Doch bei der Qualifikation zum Asien-Cup, der im gleichen Jahr stattfand, wollten Afghanistan und Pakistan nicht gegen Israel antreten, denn sie erkannten den jüdischen Staat nicht an. Dadurch kam die israelische Auswahl kampflos in die Endrunde, in der sie gegen Südkorea, Hongkong und Südvietnam spielte und das Turnier als Zweitplatzierte beschloss.
Als Nächstes stand die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 1958 an. Und nun begann ein nachgerade absurdes Theater. Denn im Laufe des Jahres 1956 verschärfte sich der Konflikt zwischen Ägypten und Israel, das sich zunehmend Angriffen durch die terroristischen Fedayin von ägyptischem Territorium und vom ägyptisch besetzten Gazastreifen aus erwehren musste. Ägypten bildete ein Bündnis mit Jordanien und Syrien, blockierte den Golf von Akaba und sperrte den Suezkanal für israelische Schiffe; es verletzte somit internationales Recht. Israel setzte sich zur Wehr und besetzte den Gazastreifen und die Sinai-Halbinsel.
Das hatte Auswirkungen auch auf den Fußball, denn die islamischen Staaten weigerten sich, Spiele gegen Israel auszutragen. Zunächst sollte Israel in der Vorrunde gegen die – islamische – Türkei antreten, doch die dachte gar nicht daran aufzulaufen. In der Zwischenrunde sollte Israel gegen – das islamische – Indonesien spielen, doch auch Indonesien trat nicht an. Schließlich sollte Israel im Finale der Ausscheidungsspiele gegen den – islamischen – Sudan ran, doch auch dieser boykottierte das Match. Von den drei vorgesehenen Spielen fand also keines statt. Damit wäre Israel eigentlich kampflos für die WM qualifiziert gewesen.
Doch dagegen hatte die FIFA etwas: Weil nicht sein kann, was nicht sein darf, loste sie kurzerhand aus allen europäischen Gruppenzweiten ein Land aus und ließ dieses gegen Israel um den letzten freien Platz beim WM-Turnier in Schweden antreten. Gegen Wales verlor Israel das Hin- und das Rückspiel jeweils mit 0:2 und war damit ausgeschieden. Die Boykottbewegung hatte dank der FIFA also doch noch ihr unsportliches Ziel erreicht, ohne dass ihr weitergehende Sanktionen gedroht hätten.
Anschließend begann eine regelrechte Odyssee für die israelische Fußballauswahl. An den Asienmeisterschaften nahm sie zwar noch bis 1972 teil, doch auch dabei war sie immer wieder mit Boykotten konfrontiert: Zu den Spielen 1962 in Indonesien beispielsweise wurde sie gar nicht erst eingeladen, und 1972 erklärte sich lediglich Südkorea bereit, in der Qualifikation gegen sie anzutreten. Israel verzichtete letztlich, zumal die arabischen Staaten angekündigt hatten, im Falle einer Qualifikation der israelischen Auswahl die Endrunde zu boykottieren. Die Asiatische Fußball-Konföderation handelte – und schloss Israel 1974 aus ihrem Verband aus. Eine Aufnahme in den europäischen Fußballverband UEFA lehnten jedoch die Staaten des Ostblocks ab. Von der FIFA war zu all dem erneut kein Wort zu hören.
Bei der WM-Qualifikation wiederum wurde die israelische Mannschaft bald von Kontinentalverband zu Kontinentalverband gereicht: Die Ausscheidungsspiele für die Turniere 1962 und 1966 bestritt Israel in der Europagruppe, die für die Wettkämpfe 1970 in der Ozeaniengruppe und die für die Endrunden 1974 und 1978 wieder in der Asiengruppe. Und so ging es munter weiter: 1982 Europa, 1986 Asien, 1990 Ozeanien. An der Qualifikation zu kontinentalen Meisterschaften – also zur Asien- oder Europameisterschaft – nahm Israel zwischen 1974 und 1994 überhaupt nicht mehr teil, weil es keinem Verband fest angehörte. Israels Klubmannschaften durften immerhin seit 1992 bei den europäischen Wettbewerben mitmachen. 1994 erfolgte dann endlich die offizielle Eingliederung in die UEFA.
Ein derartiges Hin und Her ist in der Geschichte des Weltfußballs einzigartig; kein anderer Fußballverband musste je solche permanenten Versetzungen über sich ergehen lassen. Drakonische, das heißt über Punktabzüge hinausgehende Maßnahmen gegen jene Mitgliedsverbände, die Wettbewerbsspiele gegen Israel verweigerten, mochte die FIFA nicht ergreifen. Unter Berufung auf ihre angeblich unpolitische Rolle – dazu später mehr – hielt sie sich stets heraus. Die israelischen Fußballer und die Verantwortlichen ihres Verbands begegneten dem mit einem gewissen Pragmatismus. Denn sie wollten ihre Qualifikationsspiele gerne austragen, statt darauf zu bestehen, die Punkte kampflos zugesprochen zu bekommen. Dafür flogen sie sogar bis nach Australien und Neuseeland. Angesichts dieser ausgesprochen ungünstigen Voraussetzungen ist es eine echte sportliche Sensation, was Israel 1968 bei den Olympischen Spielen und zwei Jahre später bei seiner ersten und bisher einzigen Teilnahme an einer Fußball-Weltmeisterschaft, der in Mexiko nämlich, erreichte.
Die Qualifikation für Olympia 1968 war für das israelische Team dabei noch eine vergleichsweise leichte Angelegenheit. Denn die zugelosten Gegner Burma, Iran und Indien boykottierten den jüdischen Staat. Daher genügten zwei Siege über Ceylon mit 7:0 und 4:0, um das Ticket nach Mexiko-Stadt zu lösen. Dort erreichte die Mannschaft das Viertelfinale und kam nur deshalb nicht noch weiter, weil nach einem Unentschieden gegen Bulgarien das Los über das Weiterkommen entscheiden musste und Israel diese Lotterie verlor. Bei der WM 1970 wiederum schied das Team nach zwei Unentschieden gegen Schweden (1:1) und den späteren Vizeweltmeister Italien (0:0) bei einer 0:2-Niederlage gegen Uruguay nach der Vorrunde aus. Das Tor von Mordechai Spiegler gegen Schweden blieb der bislang einzige WM-Treffer Israels.
Der erfolgreichste israelische WM-Teilnehmer ist freilich ein Schiedsrichter, nämlich Avraham Klein, der bei den Turnieren 1970, 1978 und 1982 eingesetzt wurde. 1978 leitete er das Spiel um den dritten Platz. Klein war eigentlich sogar als Referee für das Finale zwischen Gastgeber Argentinien und den Niederlanden im Gespräch, nachdem er die Partie Argentinien gegen Italien souverän geleitet hatte. Doch die Argentinier fühlten sich trotz ihres Weiterkommens benachteiligt und lehnten Klein ab. Hinzu kam, dass die herrschende Militärjunta, die Juden alles andere als freundlich gesinnt war, Anstoß daran nahm, dass Klein vor dem Spiel Argentiniens gegen Italien die Jüdische Gemeinde des Landes besucht hatte. Ihm wurde von argentinischer Seite aber auch deshalb Voreingenommenheit unterstellt, weil der Endspielgegner Niederlande hieß. Als „Kriegswaise“ hatte Klein ein Jahr lang im niederländischen Apeldoorn verbracht. Und mit Ruud Krol trug ein Mann die Kapitänsbinde der Oranjes, dessen Vater in den Jahren der deutschen Besatzung Juden das Leben gerettet hatte. Die FIFA folgte dem argentinischen Wunsch, Avraham Klein nicht das Endspiel pfeifen zu lassen, obwohl sie sonst stets betont, sich von niemandem in die Einteilung der Unparteiischen hineinreden zu lassen.
Und damit zu einer kleinen Exkursion, deren Ziel eben diese FIFA ist. Denn es lohnt sich, einen Blick auf die politische, um nicht zu sagen Kriminalgeschichte dieses sich unpolitisch wähnenden Verbands zu werfen, hinter dessen vorgeblicher Äquidistanz sich oft genug die offene Kollaboration mit den übelsten Diktaturen verbarg und verbirgt. Eine Ausnahme bildet hier lediglich der Umgang des Weltverbands mit seinem Mitgliedsland Südafrika während der Apartheid: Der Suspendierung 1964 ließ die FIFA zwölf Jahre später den vollständigen Ausschluss des südafrikanischen Verbands folgen. Dessen Wiedereingliederung wurde im Juli 1992 vollzogen.
Doch das blieb, wie gesagt, die rühmliche Ausnahme. Von der Willkür der FIFA gegenüber Israel in Bezug auf die Qualifikation zur WM 1958 war ja bereits die Rede. Ein weiterer markanter Beleg für die Gesinnung, die bei dieser mächtigen Organisation herrscht, findet sich im Jahr 1974. Für die damalige Endrunde, die erstmals in der Bundesrepublik Deutschland stattfand, hatte sich auch das Chile des Diktators Augusto Pinochet qualifiziert. Im Land wurden Abertausende von Menschen gefangen gehalten, gefoltert und ermordet, nicht zuletzt in großen Fußballstadien. Die FIFA sah jedoch keine Veranlassung, Chile von der Qualifikation auszuschließen. Stattdessen kam es beim entscheidenden Playoff-Spiel der Chilenen zu einer der absurdesten Begegnungen, die sich jemals beim Fußball zugetragen haben. Denn Chiles Gegner war die Sowjetunion, und die weigerte sich nach einem 0:0 im Hinspiel, im Nationalstadion von Santiago aufzulaufen, wo kurz zuvor noch Pinochets Schlächter ihrem Handwerk nachgegangen waren. Die FIFA hatte vor dem Match eine Delegation nach Chile entsandt, deren Bericht eindrucksvoll dokumentiert, wes Geistes Kind man in diesem Laden ist: „Der Rasen befand sich in einem herrlichen Zustand, und alle Gefangenen befanden sich noch in den Umkleidekabinen“, hieß es dort unter anderem.
Da der Weltfußballverband das Stadion also für tauglich befunden hatte, wurde am 21. November 1973 das Spiel vom österreichischen Schiedsrichter Linemayr angepfiffen – allerdings ohne das sowjetische Team. Auf dem Platz standen elf chilenische Spieler, auf den Rängen befanden sich ein paar bestellte Anhänger des Regimes. Die Hausherren schoben den Ball ein paar Mal hin und her und dann ins gegnerische Tor. Da niemand da war, um den folgenden Anstoß durchzuführen, brach der Referee das Spiel ab. Später wertete es die FIFA mit 2:0, schickte Chile zur WM und bestrafte so die Sowjetunion für ihren politischen Ungehorsam.
Zwei Jahre nach der WM in Westdeutschland putschte sich in Argentinien – dem Land des nächsten Gastgebers – die faschistische Militärjunta des Generals Videla an die Macht. Erneut unternahm die FIFA nichts; die WM-Spiele fanden in Stadien statt, in denen zuvor, wie schon in Chile, Menschen eingepfercht, gefoltert und hingerichtet worden waren. Diktator Videla versuchte, die Weltmeisterschaft als Bühne zu benutzen. In den Niederlanden und Frankreich wurde ein Boykott des Turniers diskutiert, doch die FIFA dachte gar nicht daran, Argentinien die Wettkämpfe zu entziehen.
Sie schritt auch nicht ein, als Saddam Husseins Sohn Uday im Jahre 1997 irakische Fußballer foltern ließ, weil die sich nicht für die WM in Frankreich qualifiziert hatten, und drei Jahre später noch einmal, als das Team bei den Asienmeisterschaften nicht über das Viertelfinale hinausgekommen war. Sie blieb passiv, als die Taliban UN-finanzierte Fußballplätze zur Folter und Ermordung hunderter Menschen missbrauchten – teilweise in den Pausen von Fußballspielen –, während sie von den Tribünen mit dem Ruf „Gott ist groß!“ angefeuert wurden. Die FIFA konnte sich auch nicht vorstellen, den Iran von der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland zu disqualifizieren. Und das, obwohl dessen Präsident Mahmud Ahmadinedjad – der lange Zeit überlegt hatte, der iranischen Mannschaft nach Deutschland zu folgen – mehrfach unverhohlen mit der Vernichtung Israels gedroht hatte. Doch den FIFA-Präsidenten Joseph Blatter focht das nicht an. Ein Ausschluss des Iran sei für ihn „undenkbar“, sagte er. Denn: „Wir würden nie auf Grund irgendwelcher politischer Aussagen einen Verband ausladen. Wir sind in politischen und religiösen Fragen absolut neutral.“
Wie neutral, zeigte sich einmal mehr im April 2006. Da schickte der Weltverband dem israelischen Botschafter in der Schweiz, wo die FIFA ihren Sitz hat, eine an die israelische Regierung gerichtete Beschwerde. Der Grund: Die israelische Armee hatte ein Fußballstadion im Gazastreifen unter Beschuss genommen. Die FIFA teilte dem israelischen Diplomaten mit, sie erwäge „Maßnahmen wegen des Luftschlags“. Dabei kam der israelische Angriff auf das leere Stadion durchaus nicht grundlos. Er war zum einen eine Antwort auf Angriffe der Hamas mit Kassam-Raketen am Tag zuvor, bei denen unter anderem eine Rakete auf einem Fußballplatz eines Kibbuz’ nahe Ashkelon gelandet war. Zum anderen diente das Stadion in Gaza als Trainings- und Ausbildungslager für den Islamischen Djihad und die Al-Aqsa-Märtyrer-Brigaden sowie als Raketenabschussrampe.
Das alles interessierte die FIFA jedoch nicht, und so schrieb ihr Vertreter „für besondere Aufgaben“ mit dem klangvollen Namen Jérôme Champagne den besagten Brief an den israelischen Botschafter und bat ihn darum, „zu erläutern, warum das Stadion beschossen wurde, bevor die FIFA darüber entscheiden konnte, welche Maßnahmen, wenn überhaupt, zu ergreifen sind“. Ein Fußballstadion zu beschießen, sei jedenfalls „absolut kontraproduktiv für den Frieden, denn heute ist Fußball das einzige universelle Werkzeug, das Gräben überbrücken kann“. Und einmal in Fahrt, wurde Champagne gegenüber den Medien noch deutlicher. Die israelischen Grenzübergänge hätten es den Palästinensern seit 2000 verunmöglicht, ihre eigene Liga aufzubauen, sagte er, und: „Der Gazastreifen ist seit 1967 besetzt. Frankreich wurde von Deutschland drei Mal in den letzten hundert Jahren besetzt. Meinen Sie, wir hätten nach sechs Monaten einfach Frieden schließen können? Kein Teil von Israel ist von Palästinensern besetzt. Es ist falsch, ein Volk zu besetzen.“ Also bezahlte die FIFA die Instandsetzung des Stadions im Gazastreifen, während sie sich um den von einer Kassam-Rakete demolierten Fußballplatz in dem erwähnten Kibbuz nicht weiter scherte. So kann man eine Gleichsetzung Israels mit Nazideutschland auch zum Ausdruck bringen und einmal mehr demonstrieren, was man unter „absoluter Neutralität“ versteht: in diesem Fall eine tiefe Zuneigung zu den Feinden des jüdischen Staates.
Und dabei schafft die FIFA noch weitergehende Fakten. Denn sie orientiert sich nicht zwangsläufig an bestehenden politischen Grenzen, sondern zieht ihre eigenen. Daher gehören dem Weltverband auch Mitglieder an, die keinem international anerkannten Staatswesen zuzurechnen sind. Eines davon ist die Palestinian Football Federation (PFF), 1964 gegründet und 1998 aufgenommen. Seit neun Jahren darf Palästina also offiziell Länderspiele austragen und an der Qualifikation zu internationalen Turnieren wie der Weltmeisterschaft teilnehmen. Darüber hinaus erfreuen sich die palästinensischen Kicker einer besonderen finanziellen und logistischen Förderung durch die FIFA, etwa in Form des Goal-Projekts, mit dem, so heißt es, die fußballerische Infrastruktur verbessert werden soll.
Dagegen wäre gewiss nichts einzuwenden, würden die Sportplätze nicht regelmäßig auch den bereits geschilderten anderen Zwecken dienen, und würden Fußballspiele in den palästinensischen Gebieten nicht immer wieder in antisemitische Manifestationen verwandelt. So wurde beispielsweise 2003 ein Amateurturnier nach einem Selbstmordattentäter benannt, der im März des Vorjahres in Netanya 31 Menschen bei einer Pessach-Feier getötet hatte. Dessen Bruder kam anschließend die Ehre zu, dem Sieger dieses Märtyrerturniers den Pokal überreichen zu dürfen. Und im Herbst 2007 fand in einer Schule in Tulkarem in der Westbank neuerlich ein Fußballturnier statt, das den Namen eines mörderischen Judenhassers trug: Ziyad Da’as, ein städtischer Kommandeur der Tanzim-Milizen innerhalb der Fatah, war für die Planung eines Attentats verantwortlich, bei dem im Januar 2002 während einer Bat-Mitzvah-Feier in Hadera sechs Menschen ermordet und 30 verletzt wurden, und er stand zudem hinter der Entführung und Ermordung zweier Israelis in Tulkarem im gleichen Monat. Im August 2002 töteten ihn schließlich israelische Soldaten. Grund genug für die Schulleitung in Tulkarem, an ihn mit einem Wettbewerb zu erinnern, und Anlass für eine Zeitung der Palästinensischen Autonomiebehörde, Ziyad Da’as als „einen der mutigen Menschen des palästinensischen Widerstands“ zu rühmen, den die israelischen Besatzungstruppen „kaltblütig ermordet“ hätten: „Am Ende des Turniers“, schrieb das Blatt, „bezeugten die Zuschauer, dass der Wettkampf geeignet war, des mutigen Märtyrers Ziyad Da’as, die Gnade Allahs sei mit ihm, zu gedenken, und dass alljährlich ein Turnier an seinem Todestag stattfinden soll“. Die Ausscheidung des Jahres 2007 gewann übrigens eine Mannschaft, die sich nach den „Märtyrern“ des südlichen Viertels von Tulkarem benannt hatte. Ob es das ist, was sich die FIFA unter einer „Verbesserung der fußballerischen Infrastruktur“ vorgestellt hat?
In vielerlei Hinsicht ähnelt die Politik des Weltfußballverbands also der Politik der Vereinten Nationen, von denen Israel ebenfalls nichts als regelmäßige Benachteiligungen zu erwarten hat, während seine Feinde stets ungeschoren davonkommen und sich nicht selten besonderer Zuneigung erfreuen. Und dann gibt es da ja noch den gar nicht so kleinen Bruder der FIFA, den europäischen Fußballverband UEFA. Seit 1994 ist Israel, wie bereits gesagt, dessen festes Mitglied. Doch von einer Liebesbeziehung kann wahrlich keine Rede sein, denn auch die UEFA wirft den israelischen Fußballern allenthalben Knüppel zwischen die Beine und beschert den israelischen Klubs wie auch der Nationalmannschaft immer wieder handfeste Wettbewerbsnachteile. Als beispielsweise die Zweite Intifada ab dem Jahr 2000 ihren antisemitischen Terror ausagierte, mussten israelische Teams auf Geheiß des europäischen Verbands ihre Heimspiele in den internationalen Wettbewerben auf Zypern austragen, weil es den anreisenden Klubs angeblich nicht zuzumuten war, in Israel zu kicken. Erst nach dem Bau des Sicherheitszauns und dem Rückgang der Selbstmordattentate genehmigte die UEFA im April 2004 wieder die Austragung von Partien im Land.
Einer der ersten Klubs, die in den Genuss solcher echten Heimspiele kamen, war in der Saison 2004/05 Maccabi Tel Aviv. Maccabi hatte sich für die Gruppenphase der Champions League qualifiziert und traf dort unter anderem auf den deutschen Meister FC Bayern München. Das Hinspiel in Tel Aviv hatte die UEFA jedoch auf den jüdischen Neujahrstag Rosh Hashanah gelegt. Dieses Fest ist neben dem zehn Tage später gefeierten Yom Kippur bekanntlich einer der höchsten jüdischen Feiertage, an dem die religiösen Familien die Synagoge zu besuchen pflegen. Maccabi bat daher um eine Vorverlegung der Partie um einen Tag und hatte dafür bereits die Zustimmung des FC Bayern sowie des Fernsehens eingeholt. Somit waren eigentlich alle Hindernisse aus dem Weg geräumt. Doch die Funktionäre der UEFA sperrten sich. „Wir können es nicht akzeptieren, wenn jeder anfängt, nationale, religiöse oder politische Feiertage als Argument für eine Verlegung zu benutzen“, sagte der Mediendirektor der UEFA, William Gaillard. Bei den Bitten anderer Nationalverbände oder Klubs war man zuvor deutlich entgegenkommender gewesen, zumal dann, wenn alle Beteiligten mit der Verlegung eines Spiels einverstanden waren. Doch nun stellte man auf stur. Selbst ein Amtshilfeersuchen des israelischen Außenministers Silvan Shalom an seinen deutschen Kollegen Joschka Fischer und ein Appell des Zentralrats der Juden in Deutschland an die UEFA halfen nichts. Das Spiel wurde nicht verschoben und fand schließlich vor halbleeren Rängen statt.
Während des Libanonkrieges im Sommer 2006 und noch längere Zeit danach wurden israelische Klubs dann erneut für den Terror bestraft, der den jüdischen Staat heimsuchte. Hapoel Tel Aviv, Bnei Yehuda Tel Aviv und Beitar Jerusalem mussten ihre Heimspiele in der Qualifikation für den UEFA-Pokal jenseits der Landesgrenzen austragen, ebenso Maccabi Haifa seine Playoffs zur Champions League. „Durch den Krieg mit der Hizbollah im Süden des Libanon ist die Sicherheit der Sportler in Israel nicht ausreichend gewährleistet“, behauptete die UEFA. Iche Menachem, Präsident des Israelischen Fußballverbands, war fassungslos: „Wir werden diese Entscheidung nicht unwidersprochen akzeptieren. Ich fordere die UEFA-Offiziellen auf, ihre Entscheidung hier im Land zu treffen und nicht in ihren Büros in der Schweiz.“ Wenn Popgruppen wie Depeche Mode in Israel spielen könnten, sei das auch Fußballvereinen zuzumuten. Man erwog zeitweilig sogar eine Klage vor dem internationalen Sportgerichtshof CAS.
Anfang September 2006 traf die Heimspielsperre dann auch das israelische Nationalteam. Sein erstes Spiel in der Qualifikation zur Europameisterschaft gegen Andorra musste es im niederländischen Nijmegen bestreiten – und das auch noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Dabei hatte die UEFA kurz zuvor noch angekündigt, dass dieses Match in Tel Aviv stattfinden könne, wenn sich der Waffenstillstand als stabil erweise. Das war zwar der Fall, doch die UEFA wollte von ihrem Versprechen plötzlich nichts mehr wissen. Das brachte Israels Sportminister Ophir Pines-Paz auf die Palme: „Man muss begreifen, dass wir über zwei antisemitische schwedische Funktionäre sprechen. Diese beiden Schweden, die gegen uns arbeiten, sind diejenigen, die die Entscheidungen treffen. Und sie hassen uns.“ Dieser Zornesausbruch, der sich gegen den damaligen UEFA-Präsidenten Lennart Johansson und dessen Generaldirektor Lars-Christer Olsson richtete, war ohne Zweifel nachvollziehbar. Denn die vorgeblichen Sicherheitsbedenken muteten mehr als fragwürdig an. Würde die UEFA in allen Fällen mit gleichem Maß messen, hätte sie zumindest auch die Heimspiele spanischer und englischer Teams nach den Terrorangriffen von Madrid und London oder die Partien türkischer Mannschaften nach dem Anschlag in Antalya im August 2006 verlegen müssen. Doch nichts dergleichen geschah, und daher müssen sich die Verantwortlichen des Verbands den Vorwurf gefallen lassen, eine explizit politische Entscheidung getroffen zu haben.
Eigenartig auch, dass die UEFA den israelischen Erstligaklub Hapoel Tel Aviv im September 2007 zu einer Geldstrafe von 30.000 Euro verurteilte, weil dessen Anhänger während des UEFA-Pokal-Qualifikationsspiels beim Verein NK Siroki Brijeg randaliert hatten – nachdem Fans des bosnischen Vereins die israelische Supporter unter anderem mit Naziparolen und dem Hitlergruß provoziert hatten. Das kostete Brijeg jedoch nur 3.000 Euro. Überhaupt keine Strafe musste gar der französische Klub Paris St. Germain zahlen, obwohl ein Teil der Zuschauer beim UEFA-Pokal-Spiel gegen Hapoel Tel Aviv im November letzten Jahres antisemitische Parolen gegrölt hatten. Nach der Partie kam es überdies zu einer regelrechten Hetzjagd auf Hapoel-Anhänger durch Paris, bei der schließlich einer der Angreifer von einem Polizisten erschossen wurde.
All diese Beispiele zeigen, dass de FIFA und der europäische Verband UEFA in ihrem Umgang mit der Israeli Football Association auf der Ebene des Fußballs ganz ähnlich vorgehen wie die Vereinten Nationen mit dem jüdischen Staat auf politischer Ebene: Sie legen an Israel regelmäßig andere Maßstäbe an als an ihre übrigen Mitglieder, sie treffen immer wieder Entscheidungen zum Nachteil Israels, und sie unterlassen Konsequenzen gegenüber jenen, die aus ihrer prinzipiellen Ablehnung Israels keinen Hehl machen, um es zurückhaltend zu formulieren. Man könnte sie deshalb als eine Art Fußball-Uno bezeichnen, zumal ihr Vorgehen Auswirkungen weit über den Sport hinaus hat und gesellschaftliche Relevanz besitzt.
Dazu passen auch die regelmäßigen Boykotte iranischer Spieler, wenn sie mit ihrem jeweiligen Klub gegen eine israelische Mannschaft antreten sollen. Im Herbst 2004 beispielsweise spielte der deutsche Rekordmeister Bayern München, wie bereits erwähnt, in der Champions League gegen Maccabi Tel Aviv. Dabei fehlte sowohl im Hin- als auch im Rückspiel der inzwischen für Hannover 96 kickende iranische Nationalspieler Vahid Hashemian. Die offizielle Begründung lautete, der Angreifer sei verletzt. Dass das nur vorgeschoben war, lag gleichwohl nahe. Denn der iranische Verband hatte Hashemian mit Konsequenzen gedroht, sollte er mit den Münchnern gegen Maccabi spielen.
Und Anfang Oktober 2007 gab es eine Menge Wirbel um den deutschen U 21-Nationalspieler Ashkan Dejagah vom VfL Wolfsburg. Denn der weigerte sich, mit zum Europameisterschafts-Qualifikationsspiel der DFB-Auswahl in Israel zu reisen. Die Spekulationen über seine Motive heizte Dejagah dabei selbst an. „Das hat politische Gründe. Jeder weiß, dass ich Deutsch-Iraner bin“, wurde er in verschiedenen Zeitungen zitiert. Weiter sagte er: „Ich habe mehr iranisches als deutsches Blut in meinen Adern. Außerdem tue ich es aus Respekt, schließlich sind meine Eltern Iraner.“ Von einer Furcht vor möglichen Nachteilen für seine Verwandten im Iran oder davor, dass ihm selbst künftig die Einreise in den islamischen Staat verweigert werden könnte, war erst die Rede, als die Proteste gegen Dejagah und gegen die äußerst nachsichtige Haltung des DFB zunahmen und sich zudem herausstellte, dass Dejagah doch nicht mehr, wie ursprünglich angenommen, für die A-Nationalmannschaft des Iran spielberechtigt ist.
Dass sich sowohl die UEFA als auch die FIFA aus solchen Fällen heraushalten, ist angesichts der geschilderten Benachteiligungen Israels einerseits sicher nicht verwunderlich. Andererseits handelt insbesondere der Weltfußballverband mit seinem beharrlichen Schweigen letztlich gegen seine eigenen Grundsätze. Denn die FIFA verbittet sich normalerweise jegliche Einmischung der Politik in den Fußball und schließt bei einer Zuwiderhandlung auch schon mal ein Mitgliedsland vorübergehend aus. Doch sie hat bis heute nie darauf reagiert, dass das Mullah-Regime iranischen Fußballern Wettkämpfe gegen israelische Teams strikt untersagt und ihnen mit massiven Sanktionen nicht nur sportlicher Art droht, wenn sie sich diesem Verbot widersetzen.
OLYMPISCHE BOYKOTTE GEGEN ISRAEL
Boykotte gegen israelische Athleten hat es aber nicht nur im Fußball, sondern auch in weiteren Sportarten gegeben. Zwei Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit möchte ich dabei nennen, und an beiden war wiederum der Iran beteiligt. Bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen weigerte sich der hoch favorisierte iranische Judo-Weltmeister Arash Miresmaeili, gegen den Israeli Ehud Vaks anzutreten. Vaks kam kampflos eine Runde weiter, während Miresmaeili von der politischen Führung seines Landes gefeiert wurde: „Der Name von Arash Miresmaeili wird in die iranische Geschichte eingehen als ein Quelle des Stolzes für das Land“, lobte ihn der damalige Staatspräsident Mohammad Khatami. Weiter sagte er: „Das großartige Handeln und die Selbstaufopferung unseres Champions, der auf eine sichere Olympiamedaille aus Protest gegen Massaker, Terror und Besetzung verzichtet hat, ist eine nationale Ruhmestat.“ Auch der seinerzeitige Sprecher des iranischen Parlaments, Gholam-Ali Haddad-Adel, gratulierte dem Verweigerer für seine „tapfere Entscheidung“. Vize-Sportchef Ali Kafashian schlug vor, Miresmaeili mit einem speziellen Preis zu ehren. Der Judoka erhielt vom Nationalen Olympischen Komitee des Iran schließlich eine Prämie von 5.000 Dollar.
Das Internationale Olympische Komitee (IOC) sperrte den Sportler; der Judo-Weltverband IJF verhängte jedoch keine Strafe gegen ihn oder seinen Verband. Offiziell war Miresmaeili wegen Übergewichts nicht zum Kampf zugelassen worden. Und eine Anhörung vor der IJF-Untersuchungskommission soll ergeben haben, dass Miresmaeili nie die Absicht zum Boykott des Wettbewerbs hatte. Das mutet sehr eigenartig an; schließlich hatte Miresmaeili, der Fahnenträger seines Landes bei Olympia in Athen, schon Tage vor dem Kampf angekündigt, gegen keinen Athleten aus Israel anzutreten. Mit seinem Boykott wolle er gegen die israelische Haltung im Nahostkonflikt protestieren.
Auch bei den letzten Olympischen Spielen 2008 in Peking gab es einen antiisraelischen Boykott: Der iranische Schwimmer Mohammad Alirezaei erschien nicht zu einem Vorlauf in der Disziplin 100 Meter Brust, weil mit Tom Beeri auch ein israelischer Schwimmer im Becken war. Zunächst hatte das Nationale Olympische Komitee des Iran den Start von Alirezaei erlaubt, weil dieser auf Bahn eins und der Israeli auf Bahn sieben eingeteilt waren und es sich damit nicht um ein direktes Duell gehandelt hätte. Am Ende blieb Alirezaei Platz aber doch frei. Iranischen Angaben zufolge war der Sportler erkrankt. Das IOC glaubte dieser Begründung und sprach keine Sanktionen aus.
FAZIT
Man sieht an all diesen Beispielen, dass die gegen Israel gerichteten Boykotte und die Benachteiligungen israelischer Sportler und Sportverbände eine beträchtliche Dimension haben. Vor allem die Verbände aus arabisch-islamischen Ländern weigern sich regelmäßig, ihre Sportler gegen israelische Athleten antreten zu lassen. Oft nehmen dabei die jeweiligen Regierungen beziehungsweise Regimes – wie jenes im Iran – direkten Einfluss auf die Entscheidungen der Sportverbände und sorgen so für eine unmittelbare Verquickung von Sport und Politik. Die Nichtanerkennung Israels auf politischer Ebene führt dann auf sportlicher Ebene dazu, Wettkämpfe gegen Athleten und Mannschaften aus dem jüdischen Staat zu boykottieren oder gegen sie, wie im eingangs erwähnten Fall der Tennisspielerin Shahar Pe’er, auch schon mal ein Einreiseverbot zu verhängen. Doch wie die Geschehnisse rund um das Davis-Cup-Spiel im schwedischen Malmö und das Verhalten des deutschen Fußballspielers Ashkan Dejagah gezeigt haben, beschränken sich antiisraelische Boykottaktivitäten im Sport nicht auf den arabisch-islamischen Raum.
Und diese antiisraelischen Aktivitäten sind, um es deutlich zu sagen, antisemitisch motiviert. Denn Israel kann tun und lassen, was es will – stets wird es nicht nur in seinen Nachbarstaaten für alles Unheil im Nahen Osten verantwortlich gemacht, sondern auch in unseren Breitengraden: Als sich beispielsweise die israelische Armee und jüdisch-israelische Siedler noch im Gazastreifen aufhielten, galten sie als Besatzer. Als sie sich 2005 zurückzogen, intensivierten palästinensische Terrorgruppen zum Dank ihren Raketenbeschuss, woraufhin Israel die Grenzkontrollen verschärfte – und sich fortan dem Vorwurf ausgesetzt sah, „das größte Gefängnis der Welt“ errichtet zu haben. Lässt der jüdische Staat den Raketenhagel über sich ergehen, wird er in der arabisch-muslimischen Welt als Schwächling verhöhnt. Reagiert er aber mit Sanktionen oder Gegenschlägen, dann handelt er „unverhältnismäßig“ oder „alttestamentarisch“, befördert die „Gewaltspirale“ oder begeht gar ein „Massaker“. Kurzum: Gleich, was Israel unternimmt, seine Gegner und Feinde sehen darin immer nur weitere Belege für seine abgrundtiefe Bösartigkeit. Dieses Denkmuster ist altvertraut und wohlbekannt; es ist ein judenfeindliches. Der Wiener Politikwissenschaftler Stephan Grigat urteilte denn auch in einem Beitrag für das Internetportal haGalil, Israel fungiere „als eine Art Jude unter den Staaten“. Der gegen Israel gerichtete Antizionismus sei eine „geopolitische Reproduktion des Antisemitismus, der das klassische Bild des geldgeilen, vergeistigten und wehrunfähigen jüdischen Luftmenschen durch jenes des alles niedertrampelnden, auf territoriale Expansion und völkische Homogenität setzenden Israeli ergänzt“. Und zu diesem antisemitischen Denkmuster gehört es dann auch, israelische Sportler gewissermaßen als Soldaten zu betrachten, die den Krieg im Sport sozusagen mit anderen Mitteln fortsetzen und die man jedenfalls boykottieren muss, weil sie Israelis sind, egal, was sie tun und denken.
Dachverbände wie die FIFA und die UEFA wiederum sind oft genug eher Teil des Problems als Teil der Lösung. Ihre offiziell bekundete Neutralität in politischen Dingen – das sollten die verschiedenen Beispiele deutlich gemacht haben – ist erstens keine, denn oft genug haben sie israelische Athleten benachteiligt, wenn diese mit Boykotten konfrontiert wurden, oder sie haben mit zweierlei Maß gemessen. Zweitens ist eine solche scheinbare Neutralität eine faktische Parteinahme für die Feinde des jüdischen Staates. Und nicht nur deshalb, sondern auch angesichts der mal sehr milden und mal gar nicht verhängten Sanktionen bei antiisraelischen Boykotten kann man den Verbänden den Vorwurf nicht ersparen, sich immer wieder zu Komplizen der Israelhasser zu machen, wo ihre Funktionäre nicht sogar selbst welche sind. Dabei hat die Profiorganisation der Tennisspielerinnen (WTA) vorgemacht, dass es sehr wohl auch anders geht.
Nach so viel Boykottgeschichten möchte ich zum Abschluss noch von einer Episode berichten, die zumindest positiv begann. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft vor drei Jahren in Deutschland holte der ghanaische Nationalspieler John Paintsil nach dem entscheidenden 2:0 seiner Mannschaft gegen Tschechien eine israelische Fahne hervor, die er in seinem Strumpf verstaut hatte, und zeigte sie jubelnd dem Publikum. Zur Begründung sagte Paintsil, der damals für Hapoel Tel Aviv spielte: „Ich liebe die Fans aus Israel, deshalb habe ich mich für diese Aktion entschieden.“ Leider hatte die Geschichte kein Happy-End, denn der ghanaische Fußballverband distanzierte sich einen Tag später von seinem Kicker und empfahl ihm sogar eine Therapie. Die Botschaft lautete also: Wer für Israel ist, kann nicht ganz richtig im Kopf sein. Bei der FIFA – und nicht nur bei ihr – wird man das im Zweifelsfall genauso gesehen haben. Denn eine Oase der Vernunft war der Weltfußballverband noch nie, sondern stets nur Mitschwimmer in einem Meer von Unsinn.“
Wir danken dem Referenten nochmals für die Bereitstellung seines Vortrags und empfehlen eine gründliche Lektüre.
- „Ausstellung erinnert an jüdische Sportrekorde“, RZ online, 19.06.2009. Mehr …
- „Wer nicht hüpft, der ist (k)ein Jude“, Jungle World, 18.06.2009. Mehr …
- „Fussball und Antisemitismus: Bomben auf Rotterdam“, Artikel von Tobias Müller für die WOZ, 28.05.2009. Mehr …
- Apropo Sport-UNO: Der amerikanische Publizist Mark Steyn sagte einmal mit rabenschwarzem Humor:
„One day the U.N. Secretary General proposes that, in the interest of global peace and harmony, the world’s soccer players should come together and form one United Nations global soccer team.
“Great idea,” says his deputy. “Er, but who would we play?” „Israel, of course.”