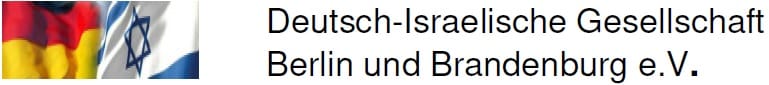Leon de Winter: Das Recht auf Rückkehr
„Das Buch ist eine Warnung“
erschienen in
DIE WELTWOCHE Nr. 40/2009
In Leon de Winters Zukunftsroman steht Israel kurz vor seiner Auflösung: Der Erfolgsautor aus den Niederlanden spricht in diesem Interview mit Peter Keller über sein neues Buch, über palästinensische Berufsflüchtlinge und über seine Idee, aus Jerusalem eine klimatisierte Einkaufsmeile zu machen.
Interview von Peter Keller
In Ihrem jüngsten Roman zeichnen Sie die düstere Utopie eines entvölkerten, überalterten, verarmten Israel im Jahr 2024. Ein von seinen arabischen Nachbarn bedrohter Schrumpfstaat. Ist diese Vorstellung für Sie ein realistisches Szenario, oder ist sie nur als literarisches Experiment zu lesen?
Wir wissen natürlich, im Jahr 2024 sind alle Menschen im Nahen Osten glücklich und reich. Die Staaten haben sich zu Demokratien gewandelt, die Diktatoren sind verschwunden. Saudi-Arabiens Öleinnahmen werden auf humane Weise genutzt. Es leben auch Christen in Mekka, und die Juden gehen nach Jeddah in die Ferien. Wir wissen, dass die Zukunft so aussieht und das, was in meinem Buch geschrieben steht, nur Blödsinn ist.
Dann wäre Ihr nächster Roman also eine positive Utopie der gleichen Geschichte?
Wenn ich dieses düstere Bild Israels beschreibe, wie ich es in meinem Buch getan habe, dann verstehen Sie, dass eine solche Zukunft nicht völlig ausgeschlossen ist. Wir reden nicht über Skandinavien, sondern über den Nahen Osten, wo es ganz andere Gesetze gibt, ganz andere Traditionen und ganz andere Wertvorstellungen.
Vielleicht kennen Sie das Märchen «Rumpelstilzchen». Dieser bösartige Wicht verliert seine Kraft, sobald man ihn beim Namen nennt. Ist das auch Ihre Vorgehensweise, dass Sie eine schreckliche Vision beim Namen nennen, um sie zu bändigen?
Das ist etwas, was ich öfters mache, eine Beschwörung. Etwas Schreckliches nicht zu verdrängen, sondern hinzuschauen, wie das Schreckliche aussieht, und zu Ende denken, was passieren könnte. In der Hoffnung natürlich, das Böse zu neutralisieren. Andererseits ging es mir darum, eine sehr traurige Geschichte von einem Vater zu erzählen, der sein Kind verliert. Es gibt nie nur eine Ursache, warum man einen Roman schreibt. Das Buch ist eine Warnung, gewiss. Aber auch ein Thriller.
Das «Recht auf Rückkehr» ist eine beklemmende Lektüre. Sie sagen auch, dass dieses Projekt sich über mehrere Jahre erstreckt hat. Ist Ihnen das Schreiben besonders schwergefallen?
Nein, nein, das Schreiben ist mir nicht schwergefallen. Ich schreibe so gerne, wie ich esse. Mit viel Geschmack. Den ersten Teil, etwa 150 Seiten, habe ich 2003 geschrieben. Dann habe ich vier, fünf Jahre versucht, die Welt zu retten. Das ist gelungen. Worauf ich den Rest geschrieben habe.
Wie haben Sie die Welt gerettet?
Indem ich etwa tausend Kolumnen, Artikel, Essays geschrieben habe. Ist die Welt untergegangen? Nein. Also habe ich die Welt gerettet. (Lacht)
In Ihrem Roman heisst es: «Der jüdische Traum von der Rückkehr in das Land der Vorväter hat bei den palästinensischen Arabern genau den gleichen Traum erzeugt.» Nun pochen beide Seiten auf ihr Recht. Sind diese Ansprüche unvereinbar?
Ja. Hier steckt ein sehr atavistischer Konflikt dahinter. Seit vor zehntausend Jahren die Menschen sich in einem bestimmten Gebiet niedergelassen haben, gibt es solche Verdrängungskämpfe. Nur finden wir heute keinen Platz mehr für diese alten Konflikte. Es gibt keine klassischen Eroberungskriege, keine Kolonialkriege mehr. Die Linien sind seit dem Zweiten Weltkrieg mehr oder weniger gezogen. Das bedeutet nicht, dass es keine gewalttätigen Auseinandersetzungen mehr gibt zwischen Völkern und ethnischen Gruppen.
Was heisst das für den Nahen Osten?
Seit 1948 sind die Palästinenser dank internationaler Institutionen imstande, als Flüchtlinge zu funktionieren. Es gab nach dem Zweiten Weltkrieg gigantische Flüchtlingsströme. Denken Sie an die Trennung von Pakistan und Indien oder an die Millionen von Deutschen, die hin und her geschoben wurden. Für keine dieser Gruppen stand eine Organisation bereit wie die Vereinten Nationen für die Palästinenser. Statt dass sie sich in ihren Nachbarländern integriert hätten, haben wir jetzt das künstliche Problem dieser Flüchtlinge. Heute besteht ein Grossteil des Einkommens der Palästinenser aus Geldern der Uno oder der EU. Damit kommen sie auf ein höheres Pro-Kopf-Einkommen als dasjenige eines Ägypters oder Syrers. Auch aus ökonomischer Sicht ist es für diese sogenannten Flüchtlinge notwendig geworden, Flüchtlinge zu bleiben.
Wenn Sie vom «Recht auf Rückkehr» reden, ist das eine rein territoriale Vorstellung von Rückkehr?
Diese Formel hat im Roman drei Bedeutungen. Das jüdische Recht auf Rückkehr, welches jedem Juden sofort die Staatsbürgerschaft Israels ermöglicht. Es gibt das palästinensische Recht auf Rückkehr. Und es gibt in meinem Roman eine ironische Bedeutung, dass die israelischen Juden in die Länder zurückkehren, aus denen ihre Eltern oder Grosseltern gekommen sind, nach Russland, Polen, Ungarn. Vielleicht gibt es auch da ein Recht auf Rückkehr.
Wenn Sie zurückkehren, wohin kehren Sie zurück?
Mein Hoffnungsland bleibt noch immer Amerika. Es ist das Land meiner Träume. Auch wenn ich weiss, dass die Realität ziemlich dunkel ist. Ich mache mir grosse Sorgen. Aber ich glaube noch immer an die Vitalität Amerikas, an das Vermögen der Menschen, ihr Leben neu einzurichten.
Ich dachte an eine Figur des Literaturnobelpreisträgers Isaac Bashevis Singer, die von sich sagte: «Im Grunde meines Herzens bin ich kein weltlicher Mensch.» Es ist eine typische Singer-Figur, die sich von der Religion entfremdet hat, und insofern wäre hier unter Rückkehr eine Rückkehr zum Judentum zu verstehen.
Ich kenne diese Sehnsucht. Zugleich bin ich das Produkt meiner Mutter. Sie war ein radikal ungläubiger Mensch. Darüber redete sie nie laut, wenn mein Vater da war, denn er war ein gläubiger Jude.
Ihr Vater erfuhr nie etwas über die Ungläubigkeit seiner Frau?
Nein, davon wusste er absolut nichts. Er wusste nicht, dass die Mutter uns Kindern zuflüsterte (de Winter senkt seine Stimme): «Es gibt keinen Gott. Glaubt es nicht. Gibt es nicht.» Sie hat uns heimlich Schweinefleisch zu essen gegeben. «Schweinefleisch ist herrlich. Aber sagt es nie Papa.» Dann haben wir, wie bei einem verbotenen Fest, bewusst das Tabu gebrochen, indem wir heimlich Schweinefleisch assen. Herrlich!
Wenn Sie Amerika als Land Ihrer Träume sehen, ist dann die Rückkehr nach Israel eine mystische Kategorie, mit der Sie persönlich nichts anfangen können?
Die Gründung Israels war absolut notwendig. Ich weiss aber nicht, ob es eine historische Pflicht für Juden gibt, dort zu leben. Auch der Rest der Welt braucht querköpfige, schwierige, lästige Juden. Im Übrigen verspürte ich nie ein besonderes Gefühl in Jerusalem. Mir war es dort immer sehr unangenehm.
Warum?
Die Luft ist mir zu schwer. Zu viele Mythen hängen rum, zu viele Erwartungen, zu viel Metaphysik, zu viel Geschichte. Mich erstickt diese Stadt. Ich habe einmal vorgeschlagen, Jerusalem abzureissen und dafür eine schöne, klimatisierte Shoppingmall zu bauen, mit vielen Parkplätzen, mit Kinos und Geschäften, die vierundzwanzig Stunden geöffnet sind. Ich habe die verrückte Idee, dass die Welt so viel besser aussehen würde. Allerdings müsste auch in Mekka gleich verfahren werden.
Es fällt auf, dass in Ihren Romanen häufig Naturwissenschaftler auftauchen. Die Astrophysikerin Dianne in «Zionoco» oder der Raumfahrtforscher Sokolow in «Sokolows Universum» und nun der Chemiker Hartog Mannheim. Ist diese Häufung Zufall?
Das ist kein Zufall. Die Naturwissenschaften sind die grosse Hoffnung der Menschheit. Wir streben nach möglichst viel Wissen, so dass wir keine blinden Opfer mehr sind von Krankheiten und Mythen. Leider kann ich nur populärwissenschaftliche Bücher lesen, was ich aber gerne tue, um etwas mitzubekommen von diesem grossen Abenteuer unserer Gehirne, dieser wunderbaren Produkte der Evolution. Sie gibt uns langsam etwas Göttliches, weil wir lernen, die Natur zu beherrschen. Ich habe unheimlichen Respekt vor Naturwissenschaftlern und ihren Leistungen. Kinder, die heute geboren werden, haben eine Lebenserwartung von hundert Jahren! Das sind wunderliche Entwicklungen. Wir sind die Prinzen der Geschichte, und jetzt werden die Könige geboren.
Und was kommt nach den Königen?
Die Götter! Wenn wir diese Welt nicht aufblasen, nicht explodieren lassen, hat die Menschheit eine wunderbare Aufgabe. Darum möchte ich, wo immer sich eine funktionelle Rolle in einer Geschichte bietet, zeigen, dass ich tief in meinem Herzen ein grosser Gläubiger des Fortschritts bin.
Sie bilden damit eine Ausnahme. Normalerweise spielen Romane der Gegenwart in einem intellektuellen Biotop, und wenn ein Naturwissenschaftler auftaucht, ist er ein Monstrum.
Ich kann nicht anders als auf diese Weise die Welt anschauen. Wie würden wir leben ohne die pharmazeutische Industrie? Wir würden leben wie die Menschen im Herzen Afrikas oder wie unsere Vorfahren: mit Ängsten und Unsicherheiten. Und jetzt erwarten wir, dass uns die Wissenschaft die ganze Zeit unterstützt mit ihren Mitteln.
Hartog Mannheim, Naturwissenschaftler und Schlüsselgestalt Ihres neuen Romans, ist ein von aussen gesehen gefühlloser Vater, der seine Arbeit über alles stellt. Was den israelisch-palästinensischen Konflikt anbelangt, bringt er es auf die Formel: Israel muss zerstören, damit Israel nicht zerstört wird. Sein Sohn Bram dagegen setzt auf Dialog und Friedensverhandlungen. Am Ende muss er einsehen, dass diese Haltung naiv war. Steckt mehr Hartog oder mehr Bram in Ihnen?
Ich bin natürlich beide. Es hängt auch vom Tag ab, ob ich als Hartog oder Bram aus dem Bett steige. Ich hoffe selbstverständlich, dass ich mich irre, dass es besser ist, den Kompromiss zu suchen, als Hardliner zu sein. Aber wenn wir sehen, was alles passiert ist in den vergangenen siebzig, achtzig Jahren, lässt sich der Konflikt offensichtlich nicht mit normalen zivilen Mitteln überwinden.
Der Publizist Henryk M. Broder stellte die Gretchenfrage: Wie geht eine demokratische und tolerante Gesellschaft mit einer Religion um, die intolerant ist und totalitär?
Wir wissen seit Karl Popper, dass wir eine tolerante Gesellschaft gegenüber den Intoleranten schützen sollen. Wir haben Ströme von Migranten nach Europa gehabt, die mehrheitlich weniger tolerant sind als diejenigen Gesellschaften, die sie aufgenommen haben. Das ist eine vollkommen neue Situation. Normalerweise gehen Menschen in ein anderes Land, um da freier zu sein und diese Freiheit zu umarmen. Wir wissen, dass das zum Teil in Europa nicht passiert ist. Immigranten, die in die USA gehen, sind meistens vom brennenden Gedanken getrieben: «Ich möchte gerne Amerikaner sein.» Von unseren muslimischen Migranten gibt es hingegen nicht so viele, die mit dem brennenden Gedanken nach Europa kommen: «Ich werde jetzt ein moderner, offener, atheistischer Europäer.»
Wie soll Europa mit dieser neuen Migration umgehen?
Das ist eine der grossen Fragen unserer Zeit. Noch vor einigen Jahren wurde man gleich als Rassist verschrien, wenn man sagte, es wäre klüger, die Immigration etwas zu reduzieren, um den schon anwesenden Immigranten besser zu helfen, sich zu integrieren. Es kann nie unsere Absicht gewesen sein, dass so viele Immigranten keine Arbeit haben, die Sprache nicht sprechen und eine so hohe Kriminalitätsrate aufweisen. Auch nicht die Absicht der Immigranten selbst.
Sie stellen damit die Frage nach dem Nutzen der Immigration für das Immigrationsland selbst.
Wir führten gerade eine grosse Diskussion in den Niederlanden über die Frage, wie die Migration der vergangenen fünfundzwanzig Jahre zu bewerten sei. Normalerweise tragen Zuwanderer wie zum Beispiel in den USA netto zum Wohlstandswachstum bei. Und in Holland? Die Regierung hat eine Berechnung verweigert, obschon das Parlament eine Immigrationsbilanz verlangt hatte. Die Zeitschrift Elsevier�s Magazine hat darauf selber eine Berechnung angestellt. Sie schätzt, dass die Immigration die Niederlande 200 Milliarden Euro gekostet hat!
Nun könnte man einwenden, bei den Immigranten gehe es um mehr als nur ihren ökonomischen Wert.
Vielleicht gibt es auch viele wunderbare Tänzer darunter. Oder die Küche ist speziell gut. Aber das waren nicht die Ursachen der Immigrationswellen. Die Menschen sind aus ökonomischen Gründen gekommen. Ich glaube, dass es deshalb auch ganz normal ist, die Immigration in erster Linie aus ökonomischer Perspektive zu beurteilen. Wenn wir wissen, dass diese Zuwanderung unheimlich viel Geld gekostet hat, ist es weder grausam noch rassistisch zu sagen: So kann es nicht weitergehen.
Trotzdem reizen Sie mit Ihrem Roman die Grenzen der Political Correctness aus, wenn Sie folgende Szene zweimal erzählen: Eine Mutter schützt ihr Kleinkind im Versteck vor feindlichen Eindringlingen, indem es ihm den Mund zupresst. Das Kind erstickt dabei. Einmal spielt die Szene im Zweiten Weltkrieg. Dann wiederholt sich die Geschichte mit arabischen Eindringlingen. Haben Sie damit eine bewusste Parallele zwischen dem nazistischen Holocaust und einem möglichen islamischen Holocaust hergestellt?
Ist diese Geschichte politisch inkorrekt? Die zweite Szene ist so passiert. Sie ist nicht erfunden. Bevor ich mit einem Roman beginne, recherchiere ich ein bis zwei Jahre. Ich gehe auf die Suche nach Einzelheiten und Anekdoten. Ich will möglichst viel wissen. Darum wimmelt es von Tatsachen in meinen Büchern. Ich erfinde natürlich eine dramatische Struktur, ich denke mich in die Charaktere hinein, ich schaffe Atmosphäre – gleichzeitig möchte ich, dass möglichst viel faktisch stimmt.
Ganz am Ende skizzieren Sie Amsterdam im Jahr 2025. Wohin werden sich die Niederlande in der näheren Zukunft entwickeln?
Da habe ich keine schrecklichen Vorstellungen. Ich denke, dass die Mehrheit der europäischen Völker an einem Punkt sagt: So wie es bis jetzt gegangen ist, geht es nicht weiter – wir ziehen eine Grenze. Menschen sind willkommen, aber als Mitbürger. Es gibt die politischen, die institutionellen und die Medieneliten, die uns ein Bild von unserer Wirklichkeit geben möchten. Gleichzeitig wissen «wir», das Volk, dass es noch eine andere Realität gibt, die alltägliche Wirklichkeit in der Strasse.
Sie zählen sich also nicht zur Elite?
Ich gehöre gewiss nicht dazu. Man sieht mich drei bis vier Mal in der Woche im Supermarkt einkaufen, und glauben Sie mir, unsere Eliten machen das nicht. Sie wissen nicht mehr, was ein Brot kostet.
Bram Mannheims Fazit gegen Ende des Romans lautet: «Ich hab mir was vorgemacht.»
Er ist am Anfang noch ziemlich unschuldig und naiv, ist sich der Gefahren nicht bewusst. Das ist auch das Schöne unseres Daseins. Wir haben die Möglichkeit und sogar das Recht, oberflächlich zu sein, uns zu vergnügen, uns nicht den ganzen Tag mit schweren Fragen konfrontieren zu müssen. Wir sehen jetzt auch im Iran das grosse Bedürfnis nach Leichtigkeit. Wir brauchen diese Abwechslung zwischen Schwerem und Unterhaltung.
Dann bescheren Sie uns als Nächstes einen leichteren Roman?
Nein. Der nächste Roman wird auch ziemlich heavy sein. Ein Buch voller Rachegefühle, eine Explosion von Wut und Gewalt. Danach möchte ich eine Geschichte schreiben über Schönheit und Zärtlichkeit. Etwas ganz Kleines und Feines mit liebevollen Farben und Tönen.