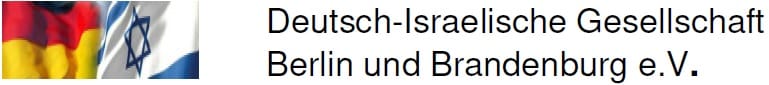Kurz vor ihrem 90. Geburtstag besuchte Margot Friedlander zum ersten Mal nach ihrer Befreiung das ehemalige Ghetto Theresienstadt.
Gute Freunde hatten sie vor dieser Reise gewarnt: „Warum willst du dir das antun?“ Margot Friedlander aber wollte nach 66 Jahren unbedingt noch einmal den Ort sehen, an dem sie die furchtbarste Zeit ihres Lebens zu überstehen hatte. Den Ort, dessen unsägliche Schrecken sie überlebte, obwohl sie, als im Ghetto von Theresienstadt internierte Jüdin, von der NS-Mordmaschinerie zur sicheren Vernichtung bestimmt war. Sie wollte sich mit diesem Ort noch einmal konfrontieren, um auf irgendeine Art mit ihm abzuschließen.
Doch jetzt steht sie mitten in dem verschlafenen tschechischen Städtchen Terezín, das einst Theresienstadt hieß, und wundert sich, wie unbekannt und fremd ihr hier alles vorkommt. Zweieinhalb Stunden ist sie geduldig dem Programm der Veranstaltung im örtlichen „Haus der Kultur“ zur Erinnerung an die Errichtung des Ghettos vor 70 Jahren gefolgt. Eine Übersetzerin hat ihr den Inhalt der auf Tschechisch gehaltenen Ansprachen, unter anderem der Bürgermeisterin sowie eines Ministers der Prager Regierung, ins Ohr geflüstert. Margot Friedlander hat der Kinderoper „Brundibár“ gelauscht, die den versammelten Überlebenden und ihren Angehörigen an diesem Vormittag vorgeführt wurde. Der Komponist Hans Krása hatte sie vor seiner Internierung in Theresienstadt geschrieben und die Partitur, die er nicht mitnehmen durfte, dort aus dem Gedächtnis rekonstruiert. Über fünfzig Mal soll sie im Lager von Kindern und Jugendlichen im Verborgenen für die Insassen aufgeführt worden sein.
Margot Friedlander hatte von diesem Werk damals in Theresienstadt zwar gehört, dort jedoch niemals einer Aufführung beigewohnt. Als sie im Juni 1944 in das Lager gesperrt wurde, gab es dort nach ihrer Erinnerung keine Theatervorstellungen mehr. Irgendwann war dieser Versuch, vor allem den jungen Lagerinsassen ein wenig Ablenkung vom grauenhaften Alltag zu verschaffen, aufgegeben worden. Zu oft hatten die Stücke umbesetzt werden müssen, weil die Schauspieler in die Vernichtungslager im Osten, vorwiegend nach Auschwitz, abtransportiert worden waren – auch der Komponist Krása kam dort um. Wer noch in Theresienstadt geblieben war, brauchte alle letzten Kräfte für den verzweifelten Versuch, irgendwie zu überleben – den Hunger, die Krankheiten, den Schmutz, den Gestank, die Wanzen, die qualvolle Enge, die sadistische Willkür der SS.
Ein ganzes langes, neues Leben liegt für sie zwischen heute und dem Mai 1945, als sie durch den Einmarsch der Roten Armee aus der Lagerhaft befreit wurde. Wenn man so will, sind es sogar zwei Leben. Denn nachdem sie 64 Jahre in den USA zugebracht hatte, wohin sie nach ihrer Rettung ausgewandert war, hat sich die gebürtige Berlinerin im Frühjahr 2010 wieder fest in ihrer Heimatstadt niedergelassen – und die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. In Berlin hatte sich Friedlander fünfzehn Monate lang im Untergrund versteckt, nachdem ihre Mutter und ihr jüngerer Bruder im Januar 1943 deportiert worden waren. Ihre Mutter hatte sich nach der Ergreifung des Sohnes bei der Polizei gestellt, um mit ihrem Sohn zu gehen, „wohin auch immer das sein mag“. Der 21-jährigen Margot hinterließ sie über eine Bekannte eine Nachricht: „Versuche, dein Leben zu machen“, und eine Bernsteinkette, die sie noch heute ständig trägt. Von da an war die junge Frau auf sich allein gestellt. Mithilfe jüdischer und nicht jüdischer Deutscher schlug sie sich im Untergrund durch, bis sie, von einem jüdischen Spitzel denunziert, aufgegriffen wurde.
Seit ihrer Rückkehr nach Berlin ist Margot Friedlander zu einer begehrten und verehrten Zeitzeugin geworden: Über 60 Mal hat sie allein in Schulen aus ihrem 2008 erschienenen Erinnerungsbuch „Versuche, dein Leben zu machen“ gelesen und mit den Jugendlichen in ihrer ebenso freundlichen wie bestimmten und unsentimentalen Art über die grauenvollen Erfahrungen ihrer Jugend gesprochen. Das Interesse und die Anteilnahme nicht nur der jungen Generation daran seien überwältigend, sagt sie. Die Einladungen zu Lesungen und Gesprächsrunden reißen nicht ab. Und am 9. November wird sie beim Bundespräsidenten zu Gast sein, der ihr das Bundesverdienstkreuz verleihen wird. Auch dort wird sie mit jungen Leuten reden. Für ihren Lebensabend hat Margot Friedlander, die am Samstag 90 Jahre alt geworden ist, eine – wie sie das selbst nennt – „Mission“ gefunden: Die Verbreitung der einfachen wie eindringlichen Botschaft an die jungen Generationen, dafür zu sorgen, dass sich entsetzliche Dinge, wie sie ihr angetan wurden, nie mehr wiederholen können.
Nach dem Ende des Vormittagsprogramms im Kulturhaus geht es zu einem Empfang mit Mittagbuffet ins „Parkhotel“. Der Weg führt über den pittoresken, frisch restaurierten, großen Platz im Zentrum des verschlafenen Städtchens, und da beginnt sich Margot Friedlander zu fragen, wo genau damals das Ghetto eigentlich verlaufen sei. Sie staunt nicht schlecht, als sie erfährt, dass sie sich bereits seit Stunden mittendrin befindet. Ja, wie das heutige Kulturhaus hatte dieser angrenzende idyllische Platz im Areal des Ghettos gelegen. Doch obwohl fast alle ihn umringenden Gebäude unzerstört stehen geblieben sind, hat er mit seinem damaligen Aussehen keine Ähnlichkeit mehr. Statt der gepflegten Parkanlage befanden sich auf ihm damals Baracken, in denen die jüdischen Häftlinge Sklavenarbeit für die SS verrichten mussten.
„So hübsch hat das hier damals ganz und gar nicht ausgesehen“, sagt Margot Friedlander mit einer Mischung aus Verblüffung und Ratlosigkeit. Es klingt fast wie eine Entschuldigung dafür, dass sie den mitgereisten Freunden keine Reaktion tiefer Erschütterung bieten kann. Wenn wir an einer Straßenecke auf ein verfallenes Haus mit heruntergekommener Fassade stoßen, zeigt sie geradezu beschwörend darauf: „So war es hier überall.“ Als wollte sie die Authentizität ihrer Erinnerungen gegen den unwirklichen Eindruck behaupten, den die Stadt heute verbreitet.
Theresienstadt ist in der Tat ein gespenstischer Ort. Wer dort einen geschlossenen Erinnerungsort mit Eingangstor und abgegrenztem Areal erwartet, wie man das von KZ-Gedenkstätten kennt, sucht vergebens. Das gesamte Städtchen ist gewissermaßen die Gedenkstätte, und das ist es sozusagen bei lebendigem Leibe. Denn es leben normale Bürger wieder ein normales Leben im heutigen Terezín, es gibt dort Läden, Gaststätten, Hotels. Die Gebäude im Bereich des ehemaligen Ghettos, die fast alle unzerstört erhalten sind, führen eine Doppelexistenz. Während sie zum Teil wieder gängigen zivilen Zwecken dienen, legen sie gleichzeitig Zeugnis ab von dem System des Grauens, das einst an diesem Ort herrschte. Im jetzigen „Haus der Kultur“ etwa war einmal die jüdische Ghetto-Polizei untergebracht, Teil jener zynisch sogenannten „jüdischen Selbstverwaltung“, die in Wahrheit ein Baustein der perfiden Ordnung der Mörder war. So war diese „Selbstverwaltung“ dazu gezwungen, Deportationslisten für den Abtransport in den Osten zu erstellen, also der SS die Selektion abzunehmen zwischen denen, die sofort in den Tod geschickt werden sollten, und jenen, die noch in der Vorhölle zur Vernichtung verweilen durften.
Beim Verlassen des „Parkhotels“, in dem die Teilnehmer der Gedenkveranstaltung mit üppiger tschechischer Küche nebst breiter Auswahl verführerischer Süßspeisen verwöhnt wurden, erfahren wir, dass an derselben Stätte die SS-Schergen eine Art Freizeit-Vergnügungsstätte unterhalten hatten. Nahezu jedes Gebäude ist hier mit solch einer grausigen Geschichte beladen. Manche bergen Zeugnisse der Vergangenheit, die der Öffentlichkeit gar nicht zugänglich sind. So etwa Dachböden, die zu Schlafsälen für Häftlinge umgebaut worden waren. Sie finden sich in bewohnten Häusern, deren Mieter nicht durch Touristengruppen aufgescheucht werden wollen, die sich aber dem Erhalt und der Pflege der düsteren historischen Hinterlassenschaft verpflichtet fühlen und sie bewahren.
Der junge Mann, der Margot Friedlander solche Einzelheiten näherbringt, ist ein Student aus Dresden, der für die Aktion Sühnezeichen ein soziales Jahr in Theresienstadt absolvierte hatte und in seiner Freizeit zu den Gedenkfeierlichkeiten hierhergekommen ist. Margot Friedlanders Übersetzerin hat ihn während des Mittagessens ausfindig gemacht. Als er von der Besucherin hört, erklärt er sich spontan bereit, ihr eine sachkundige Führung durch das Ghetto zu geben. „Ich war bei Ihrer Lesung im Jüdischen Museum in Berlin dabei“, sagt er ihr zur Begrüßung freudestrahlend. Er führt sie unter anderem in das einstige Kinderheim, in dem jetzt eine historische Ausstellung über das Ghetto untergebracht ist, und zu dem ehemaligen Spital, in dem Margot Friedlander öfter hatte behandelt werden müssen. Er zeigt ihr die verschiedenen Kasernengebäude aus der Zeit der Donaumonarchie, die zu Schlafstätten für die Häftlinge umfunktioniert worden waren. In einer von ihnen war auch Margot Friedlander untergebracht – in derselben wie ihr späterer Ehemann, den sie, freilich nur entfernt, bereits aus der Berliner Zeit kannte. In Theresienstadt hat sie ihn wiedergetroffen und lieben gelernt.
Doch Margot Friedlander gelingt es nicht, die konkreten Örtlichkeiten ihren Erinnerungen an das Lagerleben zuzuordnen, die sie in ihrem Buch so detailliert festgehalten hat. Es ist, als hätten sich ihre persönlichen Erfahrungen, die sich ihr ins Gedächtnis eingebrannt haben, und der Schauplatz , an dem sie sie machen musste, im Laufe der Jahrzehnte weit auseinandergelebt und könnten nicht wieder zusammenfinden.
Schon 1940, im Jahr nach der deutschen Besetzung der Tschechoslowakei, wurde in den Festungsanlagen Theresienstadts ein Gestapo-Gefängnis errichtet. 1941 wurde dann der gesamte, einst als österreichische Garnisonsstadt der k.u.k.-Monarchie gegründete Ort evakuiert und in ein „jüdisches“ und „arisches“ Viertel unterteilt. Hinter dieser euphemistischen Bezeichnung verbarg sich die Einrichtung eines KZ-ähnlichen Ghettos, das als Sammel- und Durchgangslager für deportierte Juden auf dem Weg in die Vernichtungslager diente. Seit November 1941 wurden dorthin tschechische Juden verbracht, seit 1942 auch Juden aus Deutschland sowie in geringerer Anzahl aus anderen europäischen Ländern. Anfangs verschleppte man vor allem alte und kranke sowie prominente deutsche Juden nach Theresienstadt. Die NS-Propaganda versuchte dabei, den Eindruck zu erwecken, in Theresienstadt werde diesem Personenkreis eine bessere Behandlung als in anderen Lagern zuteil.
Bis heute geistert durch die Öffentlichkeit die diffuse Annahme, hier habe es sich um ein KZ der „milden“ Sorte gehandelt. Zu dieser Legende mag der NS-Propagandafilm beigetragen haben, der 1944 in Theresienstadt gedreht wurde. Dazu war im Ghetto eine regelrechte Filmkulisse aufgebaut worden, die den wahren Zuständen im Lager auf zynische Weise Hohn sprach. Die Insassen wurden gezwungen, vor der Kamera glückliche, wohlgenährte und gut betreute Juden zu spielen. Auch Margot Friedlander musste bei dieser perversen Inszenierung mitmachen. In Wahrheit waren in dem von einem hohen Bretterzaun umringten und scharf bewachten Ghetto bis zu 58 000 Menschen auf einmal eingepfercht, in einem Teil der einstigen Garnisonsstadt, die ursprünglich einmal für 7000 Einwohner geplant wurde.
Erst als Margot Friedlander bei ihrem Rundgang vor einem originalgetreu nachgebauten Schlafsaal in der „Magdeburger Kaserne“ steht, rühren sich in ihr unmittelbare Erinnerungen. „Genau so haben wir damals hausen müssen“, bestätigt sie. Dutzende von Personen in einem Dachzimmer in Etagen übereinandergestapelt, die Bettstätten handtuchschmal, geschlafen werden musste auf Stroh, ein kleines Holzbrett diente zur Aufbewahrung sämtlicher Habseligkeiten des Internierten. Was man durch die Rekonstruktion freilich nicht vermittelt bekommt, sind die quälend stickige Luft und der durch die katastrophalen hygienischen Verhältnisse verursachte Gestank, der in diesem Raum herrschte. Und: „Es ist sehr seltsam, das alles jetzt so menschenleer zu sehen“, sagt Margot Friedlander. Denn der beherrschende Eindruck, der ihr vom Ghetto blieb, ist: „Menschen, Menschen, überall Menschen.“ Verzweifelte Menschen in permanenter erdrückender Enge, in der es unmöglich war, auch nur einen Augenblick allein und für sich selbst zu sein.
Wiederzuerkennen glaubt Margot Friedlander auch das unheimliche Gewölbe des „Kolumbariums“, in dem die Urnen der im nahe liegenden Krematorium eingeäscherten Toten gelagert wurden. Anfangs waren in Theresienstadt noch reguläre Bestattungen möglich, bald aber stieg die Zahl der Toten stark an, sodass man sie einfach einäschern ließ. In Theresienstadt starben insgesamt rund 33 500 Menschen, 88 000 Insassen wurden in Vernichtungslager deportiert, knapp 17 000 hatten bei Kriegsende überlebt. Die „Urnen“, in denen die Asche der Toten verstaut wurde, bestanden zumeist aus viereckigen Pappkartons. Im Herbst 1944 ließ die SS die Asche von 22 000 Verstorbenen in die nahe Eger schütten.
Im „Kolumbarium“, wo Regale mit Nachbildungen der Urnen und Gedenktafeln für im Ghetto Umgekommene zu besichtigen sind, verharrt Margot Friedlander noch eine Weile allein, bevor die Führung zu einer unscheinbaren, aber umso bedrückenderen Stelle weitergeht. Es handelt sich um ein Stück der Gleise, auf denen die Deportationszüge nach und aus Theresienstadt rollten. Es sind zwar nicht mehr die echten Gleise, doch hatte man sie für einen Film noch einmal originalgetreu verlegt. Bei ihrem Anblick steigen in Margot Friedlander die entsetzlichen Bilder vom Eintreffen halb toter Häftlinge aus dem Anfang 1945 aufgelösten Todeslager Auschwitz auf, die noch kurz vor Kriegsende nach Theresienstadt geschafft wurden und die sie, als Hilfskrankenschwester eingesetzt, in Empfang nehmen musste. Sie erzählt, dass die Neuankömmlinge, von denen viele an Typhus litten, eine Dusche bekommen sollten, sich aber weigerten, die Duschräume zu betreten. Da erst wurde Margot Friedlander klar, was „im Osten“, der bis dahin für sie nur die Chiffre für einen Ort ohne Wiederkehr war, tatsächlich geschehen war – und dass sie ihre Mutter und ihren Bruder niemals mehr wiedersehen würde.
Am Morgen nach dem Besuch in Theresienstadt sitzt Margot Friedlander in der Verwaltung des Jüdischen Museums in Prag bei einer Pressekonferenz. Vorgestellt wird die soeben erschienene tschechische Ausgabe ihres Buches. Die mit schier unermüdlicher Energie gesegnete alte Dame wirkt nun doch ein wenig erschöpft. Fragen nach ihren Eindrücken vom Besuch im Ghetto beantwortet sie knapp, fast spröde. Dass sie dort niemanden wiedergetroffen habe, den sie von damals kannte, sei nicht verwunderlich, man habe damals kaum Freundschaften geschlossen, auch aus Angst, sie durch Deportation gleich wieder zu verlieren. Sie habe sich ganz auf sich selbst konzentriert, aufs eigene Überleben. „Verkapselt“ nennt sie diesen Gemütszustand. Mit erbaulichen Geschichten über Opfersolidarität im Lager kann Margot Friedlander jedenfalls nicht aufwarten.
Leicht ungehalten reagiert sie in Prag auf die Frage, warum denn die Juden Deutschland nicht rechtzeitig verlassen hätten, bevor sie der Vernichtung anheimgefallen seien. Hätten sie das gekonnt, hätten sie es sofort getan, antwortet sie der ahnungslosen Fragestellerin. Zudem habe sich noch Ende der 30er-Jahre niemand die auch heute noch unfassbare mörderische Konsequenz des nationalsozialistischen Judenhasses vorstellen können. „Wir waren ganz normale Deutsche, die sich von anderen nicht im Geringsten unterschieden“, sagt Margot Friedlander über sich und ihre Familie. „Die meinen doch nicht uns“, hatte ihr Vater über den berserkerischen NS-Antisemitismus gesagt.
Deutschland sei ihr Land gewesen, sie hätten es geliebt, sagt Margot Friedlander, wieder zurück in Berlin, das ihr zum zweiten Mal zur Heimat geworden ist. Umso glücklicher ist sie darüber, sich in diesem Land wieder wohlfühlen und ihm so aktiv helfen zu können, aus seiner Vergangenheit zu lernen. Der Besuch in Theresienstadt hat sie in diesem Bewusstsein bestärkt. „Das erschütternde daran war vielleicht gerade, dass er mich nicht erschüttert hat.“ Was geschehen sei, sei geschehen und nicht mehr zu ändern, sagt sie lakonisch. Jetzt seien die vielen jungen Deutschen, zu denen sie einen solch guten und hoffnungsvollen Kontakt gefunden hat, gefordert: alles dafür zu tun, dass die grauenvolle Vergangenheit immer Vergangenheit bleibt.
Lesen Sie den Artikel von Richard Herzinger bei WELT ONLINE vom 6. November 2011.