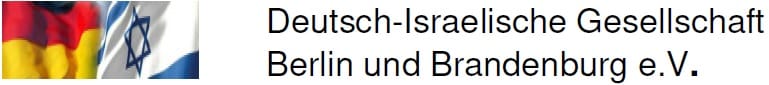„Kein Jude zu sein, tröstet sie dafür, dass sie nicht einmal Hofräte sind“, fand schon der Dichter und Journalist Ludwig Börne. Das gestörte Selbstwertgefühl der Deutschen prägte ihren Antisemitismus. Von Götz Aly
Ludwig Börne schrieb und stritt in der Epoche zwischen Napoleonischen Kriegen und Vormärz, zwischen Ghetto und Emanzipation, zwischen Postkutsche und Eisenbahn, kurz: in der Zeit des Übergangs von altständischer Ordnung zu bürgerlicher Moderne. Ihn interessierten die politische und kulturelle Gegenwart, die Menschen und deren Alltag.
Sei es, dass er die Bemerkung eines Aßmannshäuser Fährmanns aufschnappte („Ja, ein Jud’ ist gar ein schlaues Tier!“), dass er das Bulletin zur Alphabetisierungsquote französischer Rekruten las oder den Erguss eines herrschaftsfrommen Schönredners kommentierte: „Gott gab“ den deutschen Professoren „den schwächsten Kopf und damit sollen sie diese ungekochte Zeit verarbeiten! Es kommt alles wieder so roh aus ihrem Kopfe, als es hineingekommen“ sei.
Stand Börne einem heimischen Gelehrten ausnahmsweise nah, mäßigte ihn das nicht. Zu einem Werk von Friedrich Kortüm, einem Historiker, der seiner demokratischen Gesinnung wegen in die Schweiz hatte fliehen müssen, merkte er an: „So abscheulich der Stil. Ich keuchte, als wäre ich den großen Scheidegg hinaufgestiegen.“ Würden seine politischen Freunde weiterhin derart miserabel schreiben, dann, so drohte er, „werde ich lieber ein guter (französischer) Royalist, als für die Freiheit mich zu Tode zu langweilen.“
„Die Laster des Erbfeindes“
Auf Börnes Weg von Frankfurt nach Stuttgart bestieg einst ein bärtiger Jahnscher Turner die Kutsche, eigentlich ein Verbündeter im Kampf um einen freien deutschen Nationalstaat. Doch der Mann „von fürchterlicher Gestalt“ platzierte sich breitbeinig, üblen Knaster rauchend, neben ein jungvermähltes französisches Paar. Als die beiden miteinander parlierten, öffnete der Turner das Wagenfenster mit dem Hinweis, er müsse Luft holen. Es werde ihm „immer so engbrüstig, sobald er die Sprache des Erbfeindes höre“. Auch Höflichkeit zählte der Kerl, wie Börne anmerkte, „zu den Lastern des Erbfeindes“.
Die Franzosenkriege hatten im Süden Deutschlands mehr als 20, im Norden neun Jahre gedauert, bis sie 1815 mit der Schlacht bei Waterloo ein Ende fanden. Sie hatten zur lang andauernden Verarmung der deutschen Länder geführt und Millionen Opfer gefordert. Am Ende war eine ganze Generation von durch Napoleon zwangsrekrutierten oder in den Schlachten gegen ihn aufgebotenen Männern tot.
Wie nicht selten nach Kriegen, reagierte das Volk mit Starre und Veränderungsscheu; das Bedürfnis, das Alte zu bewahren, gewann die Oberhand. Auf dieser sozialen Basis entstand zweierlei: einerseits Metternichs Restauration überlebter Adels- und Kirchenmacht, andererseits der geschichtsverhangene, altdeutsch und germanisch gewandete demokratische Nationalismus eines Ernst Moritz Arndt oder Joseph Görres.
Gefährliche fremdenfeindliche Fusion
Die Härte der napoleonischen Kriegsführung und Besatzung bewirkten neben dem materiellen ein schweres, bis heute nachwirkendes ideelles Unglück. In Deutschland brachte Napoleon die revolutionären Ziele individueller Freiheit und Gleichheit in Misskredit. Aus der Gleichheit des Einzelnen vor dem Gesetz wurde in Deutschland die Vorstellung von der kulturellen Gleichheit, bald von der geschichtlich gewachsenen Bluteinheit des Volkes.
In diesem Sinne verdammte Ernst Moritz Arndt 1814 die Idee weltbürgerlicher Offenheit, weil sie die „Deutschen zu Allerweltsjuden“ mache, und forderte: „Geschieden werde das Fremde und das Eigene auf ewige Zeit!“ Die am Ende siegreichen Schlachten gegen Napoleon verherrlichten die Deutschen als Freiheitskriege.
Damit verlor auch dieser Begriff seine auf das Individuum gemünzte Bedeutung, wurde fortan volkskollektivistisch verstümmelt und als Freiheit von äußeren Feinden verstanden. Ausgerechnet in seiner Streitschrift „Für die Juden“ wies Börne 1819 darauf hin, welche gefährliche fremdenfeindliche Fusion sich ergeben hatte: Es „schmolz Freiheitstrieb und Franzosenhass in ein Gefühl zusammen“.
„Zugleich Deutscher und Jude“
Tagesaktuelle Texte beanspruchen keinen Ewigkeitswert. Dass die Schriften Börnes noch immer mit Vergnügen und Gewinn gelesen werden können, verdankt sich dem vollendeten Stil, der Geistesgegenwart, den Lebensumständen des Autors und – nicht zuletzt – dem weiteren Verlauf der deutschen Geschichte. Börne empfand es als „große Gnade“, „zugleich ein Deutscher und ein Jude“ zu sein. Die Herkunft schärfte seinen Blick; seine Gegner und Feinde verliehen ihm Energie.
In Deutschland saß er zwischen allen Stühlen, in Frankreich fand er Rückhalt und Maßstäbe, an denen er das politische Hü und Hott in seiner Heimat beurteilte. Die christlichen Deutschen, so beobachtete Börne als junger Mann, verstünden sich stets als „Trabanten“ einer „Zentralsonne“, als Untertanen „unseres Landesherren“, als Angehörige „unseres Volkes“ – jedenfalls als ein Wir. Sie suchten Schutz im Kollektiv.
Anders die Juden, sie präsentierten das pralle Ich. Unter ihnen „aber steht keiner so niedrig, dass er sich nicht als Mittelpunkt der ganzen Welt ansehen sollte“. Das deutsche Blut „schleicht langsamer als ein Zivilprozess“, mokierte sich Börne, an seinen jüdischen Brüdern und Schwestern gefielen ihm Eigensinn, Beweglichkeit und fehlende Volkstümelei. Deshalb standen sie in seinen Augen für Zukunft: „Sie sind die Lehrer des Kosmopolitismus, und die ganze Welt ist ihre Schule. Und weil sie die Lehrer des Kosmopolitismus sind, sind sie auch die Apostel der Freiheit.“
Der verschleiernde Name
Börne starb 1837 in Paris und liegt auf dem Friedhof Père Lachaise begraben. Als berühmter Toter wird er auf dem Lageplan nicht geführt. Auf dem Bronzerelief seines baufällig gewordenen Grabobelisken reichen die Freiheitsgöttinnen Deutschlands und Frankreichs einander die Hände. Geboren wurde Ludwig Börne 1786 als Löw Baruch in der Frankfurter Judengasse. Später legte er sich den seine Herkunft verschleiernden Namen zu und trat zum Protestantismus über – einfach um Ruhe zu haben. Vergeblich!
Für ungezählte Hofschreiber, Karrieristen, Ehrabschneider und Neidhammel blieb er in Deutschland, was in Frankreich niemanden interessierte – ein Jude. In der Stuttgarter Hofzeitung pöbelte im Dezember 1831 ein anonymer Rezensent, der sich als „ein Frankfurter Bürger“ vorstellte, gegen den ersten Band seiner „Briefe aus Paris“: „Frivoler Jude, herzloser Spötter, elender Schwätzer, erbärmliche Judenseele, ehrlos, seichtes Geschwätz, schamlose Frechheit, jüdische Anmaßung, elende Schmeißfliege.“
Im selben Jahr beschimpfte ihn der Hamburger Gymnasiallehrer Eduard Meyer als „entarteten Burschen“, vor allem aber als den einen: „Börne ist Jude wie Heine wie Saphir. Getauft oder nicht, das ist dasselbe. Wir hassen nicht den Glauben der Juden, (…) sondern die hässlichen Besonderheiten dieser Asiaten, die nicht mit der Taufe abgelegt werden können: die häufig auftretende Schamlosigkeit und Arroganz bei ihnen, die Unanständigkeit und Frivolität, ihr vorlautes Wesen.“
Als „Auswürfling“ verunglimpft
Ein schwäbischer Rezensent namens Wurm – ich komme auf ihn zurück – versuchte mit Hilfe seiner Schmähkritik, einen akademischen Posten zu ergattern. Es klappte. Er verunglimpfte Börne als „Auswürfling“ und erklärte ihn zum Vogelfreien, der von den Anständigen des Landes „auf beschimpfende, und wenn es nottut, denn dieses Geschlecht ist zudringlich, auf physisch empfindliche Weise entfernt“ werden müsse.
Äußerlich gelassen, reihte Börne die Wüteriche in jene „ganze Schafherde“ ein, „die gegen mich geblökt und mich mehr fürchtet als den bösen Wolf“. Doch verbarg er hinter dem Witz die Wehmut, hinter Sarkasmus und Spott den Schmerz, hinter Ironie bittere Enttäuschung. Anders als Franzosen machten Deutsche die jüdische Religionszugehörigkeit beständig zum Thema, gerade so, als seien sie von einem „bösen Zauber“ befallen, und Börne setzte hinzu: „Es ist wie ein Wunder! Tausend Male habe ich es erfahren, und doch bleibt es mir ewig neu. Die einen werfen mir vor, dass ich ein Jude sei; die andern verzeihen mir es; der Dritte lobt mich gar dafür; aber alle denken daran. Sie sind wie gebannt in diesem magischen Judenkreise, es kann keiner hinaus.“
Während seine christlichen Landsleute die Freiheit nur gegen ihre Regierungen hätten durchsetzen müssen, mussten die Juden „mit Regierungen und dem Volk streiten und haben zwei Feinde zu bekämpfen“, wie Börne 1831 schrieb. Er kannte die Ursachen des speziellen Judenhasses in seiner Heimat, weil er wusste, „dass der Deutsche gern ein Knecht ist, wenn er nur zugleich auch einen Knecht hat“.
Mangel an Mut und Zukunftsfreude
Über die Revolutionsscheu deutscher Handwerksburschen urteilte er 1831: „Diese hätten bei Freiheit und Gleichheit nichts zu gewinnen; denn während ihrer Jugend dürfen sie betteln und im Alter den Zunfttyrannen machen.“ Wurden derartige Deutsche in ihrer Herr-und-Knecht-Existenz behelligt, dann krächzten sie: „Jude, Jude!“ Das war, um es mit Börne zu sagen, „der letzte rote Heller aus der armseligen Sparbüchse ihres Witzes“.
Im Hintergrund standen der Mangel an Mut, Zukunftsfreude, Selbstvertrauen und Freiheitslust: „Die armen Deutschen! Im untersten Geschosse wohnend, gedrückt von den sieben Stockwerken der höheren Stände, erleichtert es ihr ängstliches Gefühl, von Menschen zu sprechen, die noch tiefer als sie selbst, die im Keller wohnen. Keine Juden zu sein, tröstet sie dafür, dass sie nicht einmal Hofräte sind.“
Wer glaubt, der Antisemitismus habe damals oder später nur in einer besonders übel riechenden Ecke der deutschen Nation genistet, der irrt. Wer behauptet, in der deutschen Geschichte ließen sich gute und böse Traditionen trennen, der versperrt den Weg zur Erkenntnis. Auch unter denjenigen, die wir heute ihres Reformwillens und ihrer künstlerischen Leistungen wegen ehren, finden sich bei näherem Hinsehen viele erklärte Judengegner, zum Beispiel: Karl vom Stein, Achim von Arnim, Caroline von Humboldt, Ernst Moritz Arndt, Jakob Grimm, Joseph Görres, Heinrich Hoffmann von Fallersleben, Friedrich Ludwig Jahn, Friedrich List, Richard Wagner, Friedrich Paulsen oder Franz Mehring, um nur einige zu nennen.
Liberalismus und Antisemitismus
Umgekehrt betrachtet, entstammten jene Judenfeinde, die sich um 1880 organisierten, nicht einfach der Welt des Bösen. Heinrich von Treitschke war lange Zeit Liberaler gewesen; Wilhelm Marr, der 1879 die Antisemitenliga gründete und damit den Begriff Antisemitismus in das Weltvokabular einführte, hatte 1849 als linker Flügelmann der dreiköpfigen Hamburger Revolutionsregierung angehört.
Adolf Stoecker, der ebenfalls um 1880 wirksame protestantische Volksprediger und Politiker, wird heute wegen seiner notorischen Judenhetze verachtet, folglich will niemand mehr wissen, dass er zu den engagiertesten Vorkämpfern der deutschen Sozialversicherung gehörte. Christian Friedrich Wurm, jener schwäbische Kritiker, der Börne 1831 als „Auswürfling“ geschmäht, ihm und anderen Juden „physisch empfindliche“ Maßnahmen angedroht hatte, wurde 1848 Abgeordneter der Deutschen Nationalversammlung in der Paulskirche – kein Hinterbänkler, sondern einer der Sprecher des gemäßigten Zentrums.
Der führende Liberale Wilhelm Jordan musste 1846 seiner Gesinnung wegen Sachsen verlassen, zwei Jahre später saß er als gewählter Abgeordneter in diesem Saal. Hier, von diesem Podium herab, erklärte er am 24. Juli 1848 in der Debatte um die Freiheit Polens: Er betrachte „die Überlegenheit des deutschen Stammes gegen die meisten slawischen Stämme“ als „naturhistorische Tatsache“. Deshalb sei Polen, dieses Volk „aus Edelleuten, Juden und Leibeigenen“, zu Recht dreimal geteilt worden und die Polenfrage keine Angelegenheit des Gefühls und der Freiheit, sondern des „gesunden Volksegoismus“.
„Aristokraten des Handelsstandes“
Den mit solchen Argumenten von Jordan begründeten Antrag nahmen die Abgeordneten mit 342 gegen 31 Stimmen an. Wer darüber nachdenkt, schreibt oder spricht, wie und warum Deutsche während des Zweiten Weltkriegs in Polen derart mörderisch hausten, sollte die von deutschen Demokraten in der Paulskirche begangene Ursünde nicht vergessen.
Im Jahr 1808, im Alter von 21, hatte Ludwig Börne seine erste bedeutende Schrift veröffentlicht. Sie handelte vom Streit um die Rechte, die den Frankfurter Juden gegeben oder weiterhin verweigert werden sollten. Der Autor fand, die antijüdischen Ressentiments seiner Zeit würden von neuartigen Motiven angestachelt, nämlich von „Neid und Habsucht, welche die Juden zu verderben suchten“, weil diese als „die Aristokraten des Handelsstandes die Eifersucht der Menge“ erregten: Es war nicht „die Extensität ihres Vermögens“, wie Börne zu Beginn des 19. Jahrhunderts schreiben konnte, „um die man sie beneidete – denn die jüdischen Kaufleute sind hier die reichsten nicht –, aber die Schnelligkeit und Sicherheit ihres Gewinstes konnte man ohne Ärger nicht betrachten.“
Demnach gebrauchten die Judengegner „die Religion nur noch zum Vorwand des Hasses“, und Börne wies den „Geschichtsforscher“ ausdrücklich darauf hin, dass das Motiv der Judendiskriminierung und -verfolgung „verschieden ist, je nach den Zeiten, die er in Erwägung zieht“.
Juden unter hartem Sonderrecht
Die vollen Bürgerrechte, die den Frankfurter Juden 1811 – dank des französischen Einflusses und gegen eine Zwangsabgabe von 440.000 Gulden – zugestanden wurden, beschnitten die Stadtväter fünf Jahre später. Anders als die preußischen standen die Juden dieser Stadt bis 1834 abermals unter hartem Sonderrecht. Zur Begründung der neuerlichen Restriktionen reichten den Ratsherren zwei Sätze. „Allgemeinwohl ist das erste Gesetz“ und: „Nicht unterdrücken wollen die Christen die Juden und verfolgen, sie wollen nur nicht von ihnen unterdrückt sein.“
Die nichtjüdischen Deutschen als schutzwürdige Opfer und antijüdische Zwangsmaßnahmen als Notwehr hinzustellen, das war und blieb eine Besonderheit des deutschen Antisemitismus. Er gründete in Schwäche, Kleinmut, Selbstzweifeln und Versagensangst. Die christlichen Deutschen forderten und erhielten Protektion vor den schnellen, gewandten Konkurrenten, aber das half nichts. Die Protektion untergrub das gestörte Selbstwertgefühl der Schützlinge erst recht. Aus dieser Spannung entstand der deutsche Antisemitismus der vielen kleinen Neider.
Weil jüdische Kinder die öffentlichen Schulen Frankfurts nicht besuchen durften, hatte die Jüdische Gemeinde um 1800 mehrere Privatschulen gegründet. Diese wurden regelmäßig inspiziert, und, wie Börne überliefert, stellten die städtischen Aufsichtsbeamten regelmäßig fest: Die Lehranstalten seien „vortrefflich“ und „das sittliche Betragen, der Fleiß und die Lernbegierde der Zöglinge bis zur Unbegreiflichkeit groß“.
Vorsprung in der Bildung
Anders die Schulen für christliche Kinder: Sie wurden vernachlässigt, hier regierte die Rute, hier förderten weder die Eltern noch die Geistlichkeit, die Landes- oder Stadtherren die Lernfreude der Kinder. Nur selten gelangten christliche Kinder damals über das Buchstabieren und etwas Rechnen hinaus.
Vor diesem Hintergrund ist zu verstehen, was Börne 1832 so formulierte: Die Juden wurden jahrhundertelang von den Christen unterdrückt, aber auch die Christen blieben unfrei und litten an geistiger Mangeldurchblutung. Wenn aber der politische Frühling komme und allen Freiheit und Entfaltungsmöglichkeiten schenke, dann, so Börne, „wollen wir sehen, wer früher grünt, der Jude oder der Christ“.
Die deutschen Juden bestanden diese Konkurrenz mit Bravour. Um 1900 machten jüdische Schüler zehnmal so oft Abitur wie christliche. Vom quantitativen Vorsprung abgesehen, lagen die jüdischen Schüler auch in ihren (durchschnittlichen) Leistungen weit vorne. Der Bildungsvorsprung spiegelte sich bald in den Einkommensverhältnissen. Ebenfalls um 1900 entrichteten die jüdischen Steuerpflichtigen Frankfurts viermal so hohe Steuern wie die protestantischen und achtmal so hohe wie die katholischen Steuerzahler.
Sie riefen nicht lauthals „Juda verrecke!“
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts unter deutlich ungünstigeren Bedingungen gestartet, hatten die deutschen Juden am Ende einen beträchtlichen Vorsprung gewonnen und die Klippen des sozialen Aufstiegs drei- bis viermal so schnell überwunden wie die Angehörigen der insgesamt trägen christlichen Mehrheitsbevölkerung.
Wer heute in Deutschland die schon sehr Alten befragt, welche Erinnerungen sie an Juden hätten, wird oft hören: „In unserem Dorf gab es vier Juden, der eine, ein Metzger, fuhr das erste Auto.“ Oder: „Die Juden haben sich immer ziemlich viel herausgenommen.“ An Pogrome dachten diese stillen, mit sich selbst unzufriedenen Antisemiten nicht, auch riefen sie nicht lauthals „Juda verrecke!“.
Doch im Jahr 1933 kam ihre Stunde: Sie konnten ihre Unterlegenheitsgefühle an den Staat abgeben und zusehen, wie diejenigen, die sie für anmaßend hielten, die sie als gewitzte Konkurrenten empfanden, von Amts wegen in ihren Rechten zurückgesetzt und so der nichtjüdischen Mehrheit neue Chancen eröffnet wurden.
Das Beispiel Robert Havemann
Ich zitiere aus einem Brief, der mir typisch für die seinerzeit vorherrschende Stimmung erscheint, geschrieben am 31. März 1933, von einem – später in anderer Weise berühmt gewordenen – Sohn an den Vater: „Ob es gelingen wird, den Juden ihre unrechtmäßigen Privilegien zu entreißen?“, heißt es da. Der Briefschreiber meinte ja. Schließlich verfüge die „nationale Bewegung in Deutschland“ über die „nötige eiserne Energie“, und er fuhr fort: „(Hier) im Institut wird schon kaum noch gearbeitet deswegen. Schließlich haben wir weit über 50 Prozent Juden bei uns, das ist die 50-fache Menge, als erlaubt sein sollte.“
Der Briefschreiber meint, Juden sollten nur entsprechend ihrem Bevölkerungsanteil von einem Prozent in akademischen Berufen beschäftigt sein. Er arbeitete damals als Doktorand am Chemischen Institut der Berliner Universität und hieß – Robert Havemann.
Den deutschen Antisemitismus prägte das Ressentiment der Nachzügler und Langsamen, derjenigen, um ein berühmtes Wort abzuwandeln, die sich selber für die dümmeren Kerle hielten. Dramatisch verstärkt wurde er, als die Spätaufsteigenden aufzuholen begannen und dann auch schnell aufholten. Das geschah massenhaft in den 1920er-Jahren dank der guten Bildungspolitik des späten Kaiserreiches und vor allem der Weimarer Republik.
Zu schwach, um die Mauern zu schleifen
Auch das unzweifelhaft Gute kann Böses auslösen, jedenfalls dazu beitragen. Der deutsche Antisemitismus äußerte sich in ängstlicher Reserviertheit, im dumpfen Vorurteil jener, die sich als Zukurzgekommene betrachteten. Sie pflegten den kleinen, verborgenen, hinterhältigen, von Missgunst gesteuerten Hass, der, wie Börne empfand, „umso stärker“ wurde, je mehr ihnen das lichtere Zeitalter verbot, ihn in Tätlichkeit auszulassen“.
Börne wähnte seine Landsleute in einem großen Ghetto, zu schwach, die Mauern zu schleifen. Er hielt ihnen vor, dass sie, die jede Theaterzensur duldeten, noch nicht einmal „die Lachfreiheit“ errungen hätten. Während der Franzose die Freiheit wie seine Braut liebe, liebte der Deutsche sie wie seine alte Großmutter.
Wegen dieses Mangels konservierten letztere merkwürdige Gerichtsordnungen und die Prügelstrafe, Judenzwang und Zunftherrlichkeit, Bürgerdemut, Bauernnot und hohlen Adelsstolz. Auf diese Weise würde Deutschland, wie Börne spottete, bald zu einem Museum für Antiquitäten werden, bereist von „Freunden der politischen Altertümer“ aus aller Welt. „Unglückliches Volk!“ werde dann „ein Beduine mit stolzem Mitleide ausrufen“.
Freilichtmuseum des Terrors
Es ist anders gekommen, als es sich Börne in seinen Satiren ausmalte. Infolge des von ihm beklagten Knechtsinnes und der Freiheitsangst, des Neides und des Nationalkollektivismus ist unser Land heute, zumal dessen Hauptstadt Berlin, ein millionenfach besuchtes Freilichtmuseum des Terrors, der Unfreiheit, des mörderischen Hasses. Touristen besichtigen es, nicht mitleidig, sondern beklommen oder mit sichtlicher Gruselfreude.
Uns heutigen Deutschen bleibt nichts anderes übrig, als einem der Aphorismen Börnes zu folgen: „Jede Gegenwart ist eine Noterbin der Vergangenheit.“ Wir können diese „Vergangenheit weder ausschlagen“ noch unter Vorbehalten „annehmen“. Wir müssen sie, „und zwar ganz, mit ihren Schulden und ihrer Schuld antreten“. Börne kämpfte, witzelte und polemisierte mit lebhaftem Geist dafür, dass jeder einzelne Deutsche endlich von innen her frei werde, und die Freiheit wie seine Braut lieben würde – ein Ziel, für das sich noch immer zu streiten lohnt.