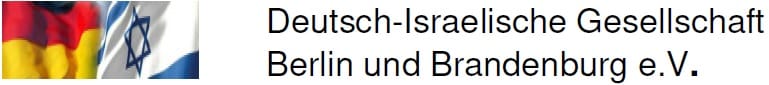Einführung von Meggie Jahn, Fotos von Fritz Zimmermann

Dr. Juliane Wetzel, Wiss. Angestellte am Zentrum für Antisemitismusforschung in Berlin (ZfA), war im Jahr 2004 schon einmal zu Gast bei der DIG Berlin. Damals ging es um eine Studie des ZfA zum Thema Antisemitismus, die vom Auftraggeber „European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia“ (EUMC) zurückgehalten worden war, nachdem sie seine besondere Qualität im Verhältnis zu anderen Rassismen herausgearbeitet und sein Vorkommen gerade auch in Migrantenkreisen hervorgehoben hatte. Ihre Ergebnisse, so damals die Befürchtung des EUMC, fördere die „Islamophobie“ in Europa.
Durchaus pikant vor dem Hintergrund aktueller Vorwürfe gegen das Zentrum im Zusammenhang mit der Konferenz „Feindbild Jude – Feindbild Moslem“ und mit dem Jahrbuch 2008, es widme sich inzwischen stärker der Islamophobie als seiner eigentlichen Aufgabe, der Erforschung des Antisemitismus, ja, setze beide Phänomene gleich. In der Diskussion machte Juliane Wetzel deutlich, dass es schon dem Gründungsvater des Zentrums, Herbert A. Strauss, darum gegangen sei, neben dem Antisemitismus auch Vorurteile gegenüber anderen Minderheiten wissenschaftlich zu untersuchen. Hinderlich sei, so Juliane Wetzel, dass trotz zahlreicher Vorstöße bisher keine öffentlichen Gelder für empirische Untersuchungen von Antisemitismus bei Migranten zur Verfügung gestellt worden seien. Das Zentrum habe sich zwar als Kooperationspartner für solche Anliegen angeboten, als Partner kämen aber nur diejenigen in Frage, die der Sprachen mächtig seien und sich in den Communities gut auskennen. Das ZfA sei aber in engem Kontakt z.B. mit den Islamwissenschaftlern Dr. Jochen Müller und Dr. Michael Kiefer.
Angesichts ihres 2008 erschienenen gleichnamigen Aufsatzes in der „Zeitschrift zum Verständnis des Judentums“ Tribüne lud die DIG die Verfasserin diesmal dazu ein, das Veranstaltungsprogramm der DIG Berlin und Potsdam im 1. Halbjahr 2009 mit einem Vortrag über „Israel in den Medien“ zu eröffnen. Durch den Gaza-Krieg und die israelkritische Berichterstattung in den Medien hatte das Thema zusätzliche und ungeahnte Aktualität erhalten.
Im Februar 2004 brachte schon Clemens Wergin, damals noch Journalist beim TAGESSPIEGEL, unter dem Titel „Der israelisch-palästinensische Konflikt in der europäischen Medienöffentlichkeit“ ein wenig Licht in das Thema. Die Lektüre des ausführlichen Berichts über diese Veranstaltung sei ebenfalls empfohlen, da der Inhalt nichts an Bedeutung verloren hat.
Mit dem Centrum Judaicum in Berlin Mitte war für den Vortrag von Dr. Juliane Wetzel ein attraktiver Veranstaltungsort gefunden, für deren Vermittlung wir uns auch hier noch mal herzlich bei der Jüdischen Gemeinde bedanken wollen, die ebenfalls eingeladen hatte.
Der gut recherchierte und spannende Vortrag fand viel Anerkennung, auch wenn sich einige Zuhörer noch mehr Bezüge zum aktuellen Gaza-Krieg gewünscht hätten.


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Mit freundlicher Genehmigung von Frau Dr. Wetzel veröffentlichen wir im Folgenden ihren Vortrag:
„Israel in den Medien“
Israel und die israelische Gesellschaft werden in den Medien und in der deutschen Öffentlichkeit zumeist nur unter dem Blickwinkel des Nahostkonflikts und als Krisenherd wahrgenommen. Die Berichterstattung ist Konflikt orientiert, im Fokus steht die physische Gewalt. Israelischer Alltag und die Vielfalt der Gesellschaft sind nur selten eine Nachricht wert, allenfalls in Features, Reportagen und in Hintergrundberichten wird der Normalität und der Vielfalt israelischen Lebens Raum gegeben.
Bereits nach dem Sechs-Tage-Krieg 1967 und mehr noch nach dem ersten Libanonkrieg 1982 hat sich in großen Teilen der deutschen Gesellschaft ein Stimmungswandel hin zu einer einseitig kritischen, wenn nicht gar negativen Haltung gegenüber Israel angedeutet. Seit Beginn der Zweiten Intifada im Herbst 2000 legt die Entwicklung den Schluss nahe, dass es heute legitim, manchmal sogar en vogue erscheint, eine anti-israelische Haltung einzunehmen. Damit schleichen sich antisemitische Denkstrukturen mehr und mehr in den öffentlichen und privaten Diskurs ein und werden von Gesellschaft, Politik und Presse seltener thematisiert und kritisiert. Auf diese Weise steigt die Akzeptanz antisemitischer Stereotype nahezu unbemerkt an. Beigetragen zu diesem Stimmungswandel hat in einer Wechselwirkung zwischen öffentlichem Diskurs und medialer Aufmerksamkeit auch eine zum Teil einseitige, wenig reflektierte und die Komplexität des Konfliktes ausblendende Presseberichterstattung.
In den letzten Jahren stand der Nahostkonflikt, mit einem speziellen Fokus auf Israel, viel häufiger im Mittelpunkt der Medienberichterstattung als Ruanda, Dafur, Tschetschenien oder andere Krisenherde in der Welt. Eine solche mediale Aufmerksamkeit, die häufig einhergeht mit einer starken Verallgemeinerung der Sachverhalte, hat einen erheblichen Einfluss auf die öffentliche Meinung. Es kann also nicht verwundern, dass über 44 Prozent der Befragten in der Studie zur „Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit“ unter Prof. Wilhelm Heitmeyer im Jahr 2004 folgender Aussage zustimmten: „Bei der Politik, die Israel macht, kann ich gut verstehen, dass man etwas gegen Juden hat.“
Seit der Zweiten Intifada und der Radikalisierung des Nahostkonflikts in den letzten acht Jahren ist Israel in den Medien präsenter denn je. Welche negativen Konnotationen dabei eine Rolle spielen, deutet die häufige Verwendung des Begriffs Al-Aqsa-Intifada als Synonym für die Ereignisse der Zweiten Intifada an. Damit ist – sicherlich nicht immer bewusst – eine Schuldzuschreibung verbunden, die die Ursache für den Ausbruch und die Eskalation des Nahostkonflikts im Besuch des damaligen israelischen Ministerpräsidenten Ariel Scharon auf dem Tempelberg am 28. September 2000 intendiert. In der internationalen, aber auch in der deutschen Presse konzentrierte sich die Berichterstattung im Wesentlichen auf die Meinung, Scharon habe mit seinem Tempelbergbesuch die Zweite Intifada ausgelöst und den Friedensprozess enorm belastet, die Verantwortung Arafats für den Ausbruch dieser Krise findet kaum Erwähnung. Ein deutlicher Anstieg der Spannungen zwischen Israel und den Palästinensern hatte sich allerdings bereits in den Wochen zuvor abgezeichnet. Am 27. September, einen Tag vor Scharons zweifellos ungeschickter Aktion, war an der Netzarim-Kreuzung im Gaza-Streifen eine israelische Militärpatrouille von palästinensischen Scharfschützen aus dem Hinterhalt überfallen worden; ein israelischer Soldat kam dabei ums Leben.
Die Netzarim-Kreuzung ist ein symbolträchtiger Ort des israelisch-palästinensischen Konfliktes. Zu Beginn der Zweiten Intifada im September 2000 verloren hier ein Palästinenser und ein Israeli ihr Leben. Am 30. September kam es dort erneut zu einem Schusswechsel zwischen den Konfliktparteien. Es sollte ein folgenreicher Zwischenfall werden, der die internationale Presse wochenlang beschäftigte. Kameraleute filmten, wie der 12-jährige Palästinenserjunge Mohammed al-Dura an der Netzarim-Kreuzung von Schüssen getroffen zusammensank. Die Weltpresse veröffentlichte die Bilder des sterbenden Jungen in den Armen seines Vaters, die beide hinter einer Tonne kauerten, als sich Palästinenser und Israelis ein Gefecht lieferten. Das Bild des Jungen, über dessen Tod heute Zweifel bestehen, machte Mohammed al-Dura zum palästinensischen Märtyrer. Bis heute präsentieren nicht nur Rechtsextreme und Islamisten die erschreckenden Szenen aus dem für das französische Fernsehen produzierten Beitrag über den Schusswechsel an der Netzarim-Kreuzung als Bilderfolge auf dem Internet, um Israel für den Tod des Jungen verantwortlich zu machen. Wie sich die Ereignisse wirklich abgespielt haben und ob der Junge tatsächlich umkam, ist heute nicht mehr eindeutig zu klären. Die Presse schrieb die Verantwortung der israelischen Armee zu, die selbst einräumte, der Junge könnte durch israelische Schüsse getötet worden sein. Nur eine Obduktion und eine ballistische Untersuchung hätten den Hergang eindeutig klären können; dies ließen die Palästinenser jedoch nicht zu.
Eine von der Journalistin Esther Schapira für den Hessischen Rundfunk produzierte Dokumentation „Drei Kugeln und ein totes Kind“ über den Fall kommt zu dem Schluss, dass die Verantwortlichen nicht mehr auszumachen sind. Einschusslöcher und Einschusswinkel deuten jedoch eher darauf hin, dass es sich um Kugeln aus palästinensischen Kalaschnikows gehandelt hat. Die Bilder, die um die Welt gingen, hatte der palästinensische Kameramann Talal Abu Rahma im Auftrag des Französischen Fernsehkanals France 2 gedreht. Der französische Auslandskorrespondent Charles Enderlin erklärte, obgleich er nicht vor Ort war, sondern in seinem Büro in Ramallah saß, den Informationen seines Kameramannes geglaubt zu haben, weil sie seiner Erfahrung in Gaza und der Westbank entsprächen: Der Kameramann behauptete, israelische Soldaten hätten den Jungen kaltblütig ermordet. Schapiras Dokumentation macht deutlich, dass sich viele vermeintliche Indizien als unstimmig und als einseitige Schuldzuschreibungen erwiesen. Der Film endet mit der Frage, wer den Jungen erschossen hat, ohne sie beantworten zu können.
Die Auseinandersetzungen um den Wahrheitsgehalt von Mohammed al-Duras Tod dauern an, in Frankreich hat die Kritik an dem Beitrag von France 2 immer wieder Gerichte beschäftigt. Im Juli 2008 forderte die Dachorganisation der französischen Juden, CRIF, die Regierung auf, die Authentizität des Originalbeitrags prüfen zu lassen. In jedem Fall zeigt dieses Ereignis, wie schnell Bilder einseitig zugeordnet und als Tatsachendokumente missbraucht werden, ohne zu reflektieren, dass gerade in solchen Konflikten Bilder als politische Werkzeuge benutzt und von der Presse unkritisch übernommen werden. Einige Stimmen in Frankreich behaupten sogar, der France 2-Al-Dura Beitrag hätte radikalisierende Wirkung gehabt und wäre ein Grund dafür gewesen, dass in Frankreich im Herbst 2000 – zu Beginn der zweiten Intifada – antisemitische Übergriffe dort so drastisch zugenommen hätten. Pierre-Andre Taguieff, Forschungsdirektor des Centre National de la Recherche Scientifique in Paris sieht gar Parallellen zur Dreyfus-Affaire: „ Die Al-Dura-Affaire ist eine der wichtigsten des 21. Jahrhunderts … Sie hat eine Symbolkraft, die ein wenig an die Dreyfus-Affaire erinnert, auch wenn es kein Unschuldiger ist, der fälschlich beschuldigt wird – es ist die israelische Armee. Es sind die Israelis, die beschuldigt werden ein Kind kaltblütig ermordet zu haben und das auch noch mit Vergnügen. Das alte Stereotyp des Ritualmordes kam mit der al-Dura-Affaire wieder auf und deshalb ist sie so überaus signifikant.“
Die einseitige Wahrnehmung, die solche Bilder wie die von al-Dura nach sich ziehen, trifft auch auf Scharons Besuch auf dem Tempelberg zu. Bereits kurz nach den Ereignissen wurde klar, dass die Zuschreibung, Scharon trage die Verantwortung am Ausbruch der Zeiten Intifada, propagandistisch aufgeladen war. Dem „Stern“ gegenüber hatte Minister Shimon Peres im Oktober 2000 erklärt, der Besuch sei mit den Palästinensern abgesprochen gewesen, die signalisiert hätten, der Besuch „sei kein Problem“, wenn Scharon sich von der Moschee fernhalte. Im Januar 2001 äußerte sich der Minister für Kommunikation der Palästinensischen Autonomiebehörde Al-Faluji öffentlich zu dem Vorfall. Er betonte, dass die Zweite Intifada lange vor dem Besuch Scharons vorbereitet gewesen wäre, und zwar unmittelbar nach Arafats Rückkehr von den gescheiterten Verhandlungen in Camp David. Al-Faluji nahm kurze Zeit später, auf Arafats Druck hin, die Aussagen zurück. Seine Rede war aber bereits in der libanesischen Zeitung „Al-Safir“ veröffentlicht worden.
Als Faluji die Verantwortung Scharons an der Eskalation des Nahostkonflikts im Herbst 2000 mit seiner Aussage relativierte, hatte sich längst die Version mit der Schuldzuschreibung an Israel durch die mediale Verbreitung in den Köpfen der Menschen festgesetzt und den öffentlichen Diskurs beeinflusst. In einer solchen aufgeheizten Stimmung ist ein kritischer Blick auf die Medienberichterstattung und vor allem ein kritisches Hinterfragen innerhalb der Zeitungs- und Fernsehredaktionen kaum noch zu erwarten. Denn wie anders ist es zu erklären, dass die New York Times und andere Presseorgane Ende September 2000 ein Bild von Associated Press veröffentlichten, das durch einen falschen Untertitel die vermeintliche Brutalität israelischer Soldaten am Tempelberg suggerierte. Das Foto zeigt einen israelischen Soldaten, der einen Schlagstock in der Hand hält und schreiend über einem blutüberströmten jungen Mann steht. Die Bildunterschrift lautet: „Ein israelischer Polizist und ein Palästinenser am Tempelberg“. Tatsächlich allerdings ist auf dem Foto der 20-jährige jüdische Student Tuvia Grossmann aus Chicago zu sehen, der an einer Jeshiva in Jerusalem studierte und von Palästinensern misshandelt worden war. Der israelische Soldat im Hintergrund versuchte ihn vor weiteren palästinensischen Übergriffen zu schützen.
Im Frühjahr 2002 wiederholte sich, was sich bereits im Herbst 2000 andeutete und ebenso während des Libanon-Kriegs 2006 und de jüngsten Verteidigungskrieg Israels im Gazastreifen zu beobachten ist. Die mediengerechte Darstellung des Konflikts, die Israel immer wieder eine besondere Brutalität unterstellt, vor allem auch durch die Wortwahl der Berichterstattung, setzt antisemitische Ressentiments frei, die in tätlichen Übergriffen auf Juden und jüdische Einrichtungen kulminieren. So waren das in den Medien im Frühjahr 2002 fälschlich als „Massaker“ titulierte Vorgehen der israelischen Aree in Dschenin und die Ereignisse in Bethlehem, als sich einige Palästinenser in der Geburtskirche verschanzt hatten, in vielen europäischen Ländern der Auslöser für antisemitische Übergriffe.
Die Präsenz des Nahostkonflikts in den Medien, linke Diskurse mit einer zum Teil unwidersprochenen einseitig pro-palästinensischen Haltung, die sich in der Berichterstattung niederschlagen und damit auch im Mainstream verfestigen, und eine Gleichsetzung von Israelis und Juden tragen dazu bei, jüdische Bürger des Landes zu willkommenen Feinden werden zu lassen, um eine negative Haltung oder gar den Hass gegen Israel auszuleben. Instrumentalisierte Jugendliche mit arabischem Migrationshintergrund fühlen sich in ihrer antiisraelischen Haltung bestätigt und versuchen mit antisemitischen Übergriffen auch die eigene schlechte soziale Lage zu kompensieren. Einen nicht zu unterschätzenden Einfluss haben hier vor allem arabische Medien, die antisemitische Stereotype – oft auch in subtiler Form – transportieren und in den europäischen Ländern zugänglich machen. Arabische Zeitungen, oft mit eigenen Ausgaben in den Zuwanderungsländern sowie das Sattelitenfernsehen tragen die Informationen schließlich bis in die Wohnstuben der in Europa lebenden Bürger mit Migrationshintergrund.
Seriöse Print- und Fernsehmedien in Deutschland berichten – bei aller gebotenen Kritik – über den Nahostkonflikt im Vergleich zu anderen europäischen Ländern wie Skandinavien, Frankreich, aber auch Großbritannien oder Griechenland relativ ausgewogen. In den genannten Ländern überwiegt demgegenüber eine einseitige pro-palästinensische Sicht, die dort nicht zuletzt auch zu einem wellenartigen Anstieg von antisemitischen Übergriffen auf die Juden des Landes geführt hat. Bestehen bleibt aber dennoch auch in Deutschland das Problem der Bilder, die viel stärker wirken als jeder Kommentar aus dem off oder jeder noch so ausführliche, gut recherchierte Artikel in der Presse, auf dessen Illustration der Journalist oft keinen großen Einfluss hat.
Dies bestätigte auch die Erhebung des Kölner Instituts für empirische Medienforschung im Dezember 2002 im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung. Das Institut untersuchte für den Zeitraum 1999 bis März 2002 die Nahost-Wortberichterstattung in den Hauptnachrichten und kam zu dem Ergebnis, dass diese in den Sendern ARD, ZDF, RTL und SAT1 überwiegend neutral gewesen sei, anders verhielt es sich hingegen bei visuellen Darstellungen. Durch die Fokussierung der Bildberichterstattung auf spektakuläre Bilder der Gewalt und ihrer Folgen, so die Analyse, entstehe eine „Asymmetrie der Konfliktstruktur und der Konfliktparteien“. Palästinensische Terroranschläge seien nie im Fernsehen zu sehen, nur deren Folgen. Der Zuschauer sieht Bilder mit Leichen, Opfer und Täter gleichermaßen, Ursache und Wirkung werden verwischt. Ins Bild gerückt werden aber Panzer, die in Flüchtlingslager eindringen oder nach einem Selbstmordattentat auf Wohngebiete feuern. Dass sich dort möglicherweise Terroristen aufhalten kann der Rezipient nicht sehen, es sei denn er wird darüber aus dem off informiert. Die Bilder aber wirken stärker und sie vermitteln den Eindruck von Israelis als Täter und Palästinensern als Opfer. Dabei spiele die Visualisierung der Gewalt eine Schlüsselrolle, so das Ergebnis der Studie.
Das Bonner Medienforschungsinstitut Media-Tenor Deutschland hingegen kam in seiner von „Bild am Sonntag“ in Auftrag gegebenen Untersuchung der Hauptabendnachrichten in ARD und ZDF in der Zeit des Libanonkonflikts im August 2006 zu dem Ergebnis, beide Sendeanstalten würden ihrer überparteilichen Berichterstattung über die Vorgänge im Nahen Osten nicht gerecht. Als Täter würde in erster Linie Israel und als Opfer die Zivilbevölkerung im Libanon dargestellt. Israelische Soldaten seien ständig im Bild und Hisbollahkämpfer würden kaum gezeigt. Kritiker werfen der Studie allerdings mangelnde Transparenz vor. Der kurze Untersuchungszeitraum von nur zwei Wochen, vom 21. Juli bis 3. August, dem Höhepunkt des Konflikts, kann tatsächlich nur eine Momentaufnahme sein. Aufschlussreicher scheint hier eine Langzeitstudie desselben Instituts über das Medienbild Israels in den deutschen Fernsehnachrichten und dessen Auswirkungen auf die Touristenzahlen von 1998 bis 2005. Danach lag die Krisenberichterstattung in den Jahren 1999 und 2000 nur bei einem Anteil von 20 Prozent, bis zum Jahr 2002 vervierfachte sich ihr Stellenwert auf 80 Prozent. Seit 2003, so Media-Tenor, zeigten die TV-Nachrichten wieder vermehrt Bilder jenseits von Krieg und Terror.
Die Studie des Duisburger Instituts für Sprach- und Sozialforschung im Auftrag des American Jewish Committee, in der für den Zeitraum September 2000 bis August 2001 die deutschen Printmedien (Tages- und Wochenzeitungen) in Bezug auf ihre Berichterstattung über die zweite Intifada unter besonderer Berücksichtigung des Israelbildes untersucht wurden, konstatierte ein Ungleichgewicht zum Nachteil Israels.
Insbesondere die Printmedien bedienen sich zum Beweis der Kritikwürdigkeit israelischen Vorgehens regelmäßig extrem kritischer Stimmen aus Israel. Kritische Meinungen aus den Reihen der Palästinenser über die Politik der Autonomiebehörde oder der Hamas werden dem Leser nur selten präsentiert. Israelis, die sich vehement gegen die Politik ihres Landes stellen, werden häufig nicht zitiert, um die Vielfalt der Meinungen in Israel zu dokumentieren, sondern sie übernehmen eine Alibifunktion, um die eigene Meinung des Journalisten oder der Redakteure zu untermauern, die glauben, sie könnten oder dürften aufgrund der historischen deutschen Verantwortung selbst keine Kritik üben. Indirekt wird hier die These kolportiert, es gebe ein Tabu, Israel kritisieren zu dürfen, wobei es an der Einsicht fehlt, dass es nicht darauf ankommt, ob kritisiert wird, sondern vielmehr wie und mit welchen antisemitischen Klischees versehen.
Nachrichten werden heute bestimmt von visuellen Darstellungen, Journalisten lassen Bilder sprechen, häufig ohne genauere Kontextualisierung der Aufnahmen. Es ist also eine Illusion zu glauben, Bilder seien objektiv. Den Konflikt, der längst ein Konflikt der Bilder geworden ist, sehen palästinensische Kameraleute oder Fotografen, ebenso wie israelische Bildjournalisten, jeweils mit ihren Augen. Der Zuschauer muss mit der Auswahl von Bildern und Filmsequenzen der Nachrichtenagenturen oder der Fernsehredaktionen vorlieb nehmen, er bekommt die Sicht des Journalisten, des Kameramanns oder des Fotografen vorgesetzt, häufig ohne deren Biographie zu kennen. Bilder aus den palästinensischen Gebieten werden überwiegend von palästinensischen Kameraleuten oder Fotografen erzeugt, dies gilt umgekehrt für Israel auch, allerdings gehören kritische Stimmen in diesem einzigen demokratischen Staat in der Region zur Normalität. Im Gegensatz zu den palästinensischen Gebieten oder dem Libanon, wo Journalisten nur in den eng gesteckten Grenzen der Machthaber arbeiten können, herrscht dort Pressefreiheit. Beschränkungen unterliegen Journalisten aber auch in Israel, wenn sie über kriegerische Auseinandersetzungen wie etwa dem Libanonkrieg im Sommer 2006 oder den jüngsten Gaza-Krieg berichten. Aus diesem Grund zeigten die Fernsehbilder des Krieges 2006 nur zivile Opfer. Bilder von Hisbollahkämpfern oder Raketenabschussrampen in libanesischen Wohngebieten hingegen waren selten zu sehen, da die Hisbollah nur Aufnahmen von zivilen Opfern zuließ; dies trifft auch jetzt wieder zu. Ebenso wenig bekommen wir palästinensische Opfer, die durch eigene Sicherheitsleute zu Tode kommen, zu sehen.
Nach den Erfahrungen im Libanonkrieg 2006 – als die Öffentlichkeit davon erfuhr, dass Bilder manipuliert worden waren – verweisen sowohl ZDF und ARD als auch insbesondere die Printmedien beim aktuellen Konflikt auf die Problematik der Berichterstattung, weil keine westlichen Journalisten in das Krisengebiet gelassen werden und die Bilder und Kommentare aus Gaza ausschließlich aus palästinensischen Quellen stammen.
In diesem Zusammenhang sei auf den unterschiedlichen Umgang mit Bildern verwiesen. Israelis vermeiden nach Möglichkeit die Publikation von Bildern toter oder durch Bombenanschläge zerfetzter Opfer, ihr Schicksal kann man allenfalls erahnen, wenn abgedeckte Leichen zu sehen sind. In Krankenhäusern sind keine Kameras zugelassen. In den Palästinensergebieten hingegen wird kaum Rücksicht auf die Pietät der Toten genommen, Kameraleute filmen in Krankenhäusern, Bilder von Leichen und verwundeten Opfern – insbesondere von Kindern – werden immer wieder in Szene gesetzt. Bitten Angehörige in Israel darum, von visuellen Berichten bei Beerdigungen Abstand zu nehmen, wird dies respektiert, in den Palästinensergebieten werden Begräbnisse zur politischen Demonstration, die keine Kamera scheuen. Trauernde Familienangehörige sind von der aufgebrachten Menge, die Särge in die Kameras hält, kaum zu unterscheiden. Solche Bilder wecken pro-palästinensische Gefühle, die einen Opferstatus der Palästinenser in der öffentlichen Meinung verfestigen. Das Bild Israels als Aggressor ist zur Normalität geworden, israelische Politiker werden als „hässlich“, als „Bulldozer“ oder Kindermörder bezeichnet oder unterstellt, Israel würde einen „Vernichtungskrieg“ führen. Solche Vokabeln, die einen Vergleich mit dem Nationalsozialismus intendieren, können entsprechend kontextualisiert durchaus antisemitische Muster bedienen. Die Vorstellung, Israel führe einen „Vernichtungskrieg“, hat sich in der Öffentlichkeit bereits derart verfestigt, dass immerhin 68,3 Prozent der für die Studie der „Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit“ Befragten eher bzw. voll der Aussage zustimmten „Israel führt einen Vernichtungskrieg gegen die Palästinenser“.
Vergeltung – Rache, das sind ebensolche Attribute, die die Medien Israel zuschreiben. Besonders zugespitzt erfolgt dies, wenn Israel nach dem falsch interpretierten Bibelzitat unterstellt wird, eine Politik „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ zu verfolgen. Das Zitat wird von Politikern, TV-Dokumentationen und in vielen deutschen Zeitungen immer wieder im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt verwendet. Es stammt aus dem 2. Buch Mose (Exodus 21:24). Die Übersetzung des Originals „ajin tachat ajin“ als „Auge um Auge“ ist falsch, richtig vielmehr ist „Auge für Auge“. Das Bibelzitat betont die Verhältnismäßigkeit der Forderungen des Geschädigten und den Schadensersatz. Die jüdische Ethik widersetzte sich damit der in biblischen Zeiten üblichen Tradition Gleiches mit Gleichem zu vergelten. In keiner jüdischen Quelle ist die Rede davon, dass einem Menschen, der einem anderen – mit oder ohne Absicht – ein Auge ausgeschlagen hat, als Strafe dasselbe angetan werden soll. Bis heute verbindet sich aber mit dem Bibelzitat die Vorstellung von Rache und es scheint besonderen Gefallen bei Journalisten zu finden, wenn sie über Israel berichten. So titelte etwa der Spiegel im April 2002, als der Nahostkonflikt im Mittelpunkt des Medieninteresses stand und europaweit eine antisemitische Welle auslöste, „Auge um Auge – Der biblische Krieg“. Eine Fotomontage setzt Arafat und Scharon ins Bild, vor dem Hintergrund biblischer Motive auf der oberen Bildhälfte, in der Mitte ein Kruzifix. Die untere Bildhälfte zeigt den ehemaligen israelischen Verteidigungsminister Mosche Dajan, einen israelischen Soldaten mit der Waffe im Anschlag, israelische Soldaten auf einem Panzer, vor einer Feuerbrunst fliehende vermummte Palästinenser, ein Kind mit erhobenen Händen. Ganz im Sinne des falsch verstandenen Bibelzitats übermittelt die Collage das vermeintlich rachsüchtige Vorgehen der Israelis.
Ein solches Zusammenspiel von Bild und Text begünstigt häufig eine antisemitische Lesart. Ein weiteres Beispiel bot das Magazin „Stern“ am 3. August 2006. Die zentrale Figur des Titelbildes ist ein junger Mann, der mit niedergeschlagenen Augen in konzentrierter Andacht verweilt. Über seinen Schultern liegt ein Gebetsschal, um den Kopf sind die Gebetsriemen gelegt und über seiner Stirn erheben sich die Kapseln der Gebetsriemen, in den Händen hält der etwa 20-Jährige ein Büchlein. Unter dem rituellen Gewand ist erst bei genauerem Hinsehen eine grüne Uniformkleidung zu erkennen. Der betende Soldat wächst förmlich aus dem, die Bildmitte einnehmenden Schriftzug „Israel“ heraus. Der Untertitel „Was das Land so aggressiv macht“ liefert die zentrale Botschaft. Dagegen scheint die zweite Unterzeile „Die Geschichte des Judenstaates“ zweitrangig, intendiert aber gleichsam, dass Israels Geschichte von Aggressivität geprägt sei.
Gerahmt ist die zentrale Figur von fünf Bildern. Rechts oben fällt ein feuernder Panzer im gleißenden Licht und von Rauchschwaden umgeben ins Auge. Symbolträchtig stellt er den direkten Bezug zum ersten Untertitel, also Israels „Aggressivität“ her. Diese Konnotation wird untermauert durch die dem Panzer gegenübergestellte israelische Fahne mit dem blauen Davidstern, teilweise verdeckt durch das rote Sternenlogo des Magazins. Die untere Bildhälfte zeigt eine Aufnahme des Felsendoms, dessen Kuppel in der Sonne glänzt und kaum zu erkennen, ein Stück der Klagemauer. Weiter unten schließt sich ein geschwungenes Stück aneinander gereihter Betonplatten an, deutlich als Mauerstück der Sperranlagen zwischen Israel und den Palästinensergebieten zu erkennen und schließlich eine schwarz-weiß Aufnahme marschierender junger Frauen, offensichtlich weibliche Pioniere aus den Gründungstagen des israelischen Staates. Frauen in militärischer Formation, qualmende Panzergeschosse und eine Mauer kontrastieren einerseits den betenden Soldaten, suggerieren andererseits aber eine Verbindung von Religion und martialischem Auftreten. Man kann sicherlich davon ausgehen, dass sich nur wenige Leser oder Passanten ein Titelbild so genau ansehen, hängen bleibt jedoch in jedem Fall der betende Soldat, die fett gedruckten Buchstaben „Israel“ und der Panzer im Blickfang, der die Botschaft „Aggressivität“ verkörpert.
Die Reportage selbst beginnt mit dem wegen unterschiedlicher Zeitangaben umstrittenen Bild eines zivilen Helfers mit grünem Helm, der die Leiche eines Kindes trägt, das während des zweiten Libanonkrieges im Sommer 2006 ums Leben kam. Aus dem einleitenden Text sticht der fett gesetzte und in Großbuchstaben gedruckte Satzteil „Brachiale Gewalt“ heraus. Die Welt sei entsetzt über diese Art der Angriffe der Israelis, so der „Stern“. Von den 23 teilweise doppelseitigen Illustrationen der Reportage zeigen nur zwei Bilder die Folgen eines Hisbollah-Angriffs auf Haifa. Der Gegner selbst allerdings wird nicht ins Bild gesetzt, mit der visuellen Darstellung wird suggeriert, Israel führe einen Kampf ohne Gegner.
Es stellt sich die Frage, ob Journalisten und Zeitungsmacher hier absichtlich Vorurteile ins Bild gesetzt haben oder ob unbewusst Stereotype verbreitet wurden. Auch wenn jeder Betrachter oder Leser seine eigene Wahrnehmung hat und Bilder bei jedem ganz persönliche Gefühle und Assoziationen wecken, so können solche Illustrationen doch antisemitische Stereotype erzeugen oder bestehende verfestigen. Journalisten, die über den Nahostkonflikt berichten, kennen die Macht der Bilder und müssen sich der antisemitischen Konnotationen bewusst sein, zumal judenfeindliche Propaganda Teil der Auseinandersetzungen im Nahen Osten ist.
Im „Stern“ vom Herbst 2006 wird allerdings noch ein weiteres Klischee bedient, das sich durch die gesamte Presselandschaft zieht: Die enge Verknüpfung von Israelis und Religiosität. Im „Stern“ ist es der Rabbiner neben einem feuernden Panzer, ein bewaffneter religiöser Siedler, ein Chassid mit Maschinengewehr, in der Berichterstattung über israelische Parlamentswahlen sind es immer wieder Bilder, die den Eindruck vermitteln, es würden nur religiöse Juden in Israel zur Wahl gehen.
Ist es nur die Einfallslosigkeit der Journalisten oder kann man den deutschen Printmedien Einseitigkeit unterstellen, wenn sie Parlamentswahlen in Israel nahezu ausschließlich mit orthodoxen Juden illustrieren? Bereits im Januar 2003 bebilderten viele Tageszeitungen ihre Berichte über die Wahlen mit streng gläubigen Juden. Kritische Stimmen gegen diese Art der Berichterstattung blieben offensichtlich folgenlos oder wurden drei Jahre später nicht mehr erinnert. Ende März 2006 wiederholte sich dieser eingeschränkte Blick, der bei den Lesern das Bild vermittelt, Israel bestünde nur aus orthodoxen Juden. Vom „Handelsblatt“ über die „Süddeutsche Zeitung“, die „Welt Kompakt“, den „Tagesspiegel“ bis hin zur „Zeit“ bebilderten seriöse Tages- und Wochenzeitungen ihre Berichte zu den Parlamentswahlen mit Pajes-tragenden, schwarz gekleideten orthodoxen Israelis.
Journalisten, Kameraleute und Fotografen können nie neutral sein, sie bringen ihre eigenen Sichtweisen und Deutungsmuster in die Berichterstattung ein, sie sind beteiligt am allgemeinen Diskurs, reproduzieren diesen oder verfestigen ihn, sie können der allgemein verbreiteten öffentlichen Meinung aber auch kritisch gegenüberstehen und versuchen diese zu modifizieren.
Vielen Dank.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Zur Person:
Frau Dr. phil. Juliane Wetzel, geb. 1957 in München, promovierte 1987 in den Fächern Geschichte und Kunstgeschichte an der Ludwig Maximilians Universität München; von 1987 bis Anfang 1991 war sie Mitarbeiterin am Institut für Zeitgeschichte, München; 1991-1995 war sie wiss. Mitarbeiterin, seit 1996 ist sie wiss. Angestellte am Zentrum für Antisemitismusforschung, Berlin. Sie ist Geschäftsführende Redakteurin des Jahrbuchs für Antisemitismusforschung, Mitglied der deutschen Delegation der Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research und hat zu den Themen Juden unter nationalsozialistischer Verfolgung (Deutschland, Frankreich, Italien), jüdischer Nachkriegsgeschichte, Rechtsextremismus und zu aktuellen Formen des Antisemitismus publiziert. Auch war sie mehrfach zu Forschungszwecken, als Konferenzteilnehmerin und auch privat in Israel. 2005 nahm Frau Dr. Wetzel als Referentin an der Konferenz des Zentrums für Antisemitismusforschung zusammen mit dem Stephen Roth Institute for the Study on Contemporary Antisemitism and Racism, Tel Aviv University, über Die Protokolle der Weisen von Zion (Oktober 2004) teil.
Frau Dr. Wetzel ist Mitglied des Ausstellungsteams zur Erarbeitung der Wanderausstellung Antisemitismus? Antizionismus? Israelkritik?, die in Kooperation zwischen dem Zentrum für Antisemitismusforschung und Yad Vashem entstand und seit Sommer 2007 an verschiedenen Orten in der Bundesrepublik gezeigt wird.