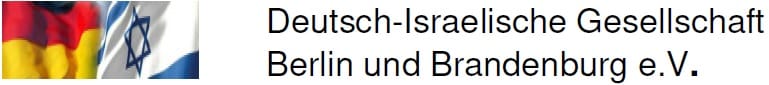Mit Ohnmacht und Hilflosigkeit registrieren wir täglich neue Meldungen über die blutigen Auseinandersetzungen im Nahen Osten und fragen uns, was wir tun können. Es ist Krieg – nicht zwischen zwei Staaten, sondern zwischen einer starken israelischen Armee und völlig unberechenbaren todes- und tötungsbereiten palästinensischen Selbstmordattentätern – eine Situation, die mit dem Bild von „David gegen Goliath“ eben nicht ausreichend beschrieben ist.
Unsere Anteilnahme und unser Mitgefühl gilt den vielen zivilen Opfern und ihren Angehörigen auf beiden Seiten, die seit Ausbruch der Al-Aqsa-Intifada im September 2000 zu beklagen sind. Die Regierungen in Israel und in den palästinensischen Autonomiegebieten scheinen unfähig, ihren Völkern die Perspektive auf ein besseres Leben bzw. ein Leben ohne Terror anzubieten. Sollten nicht beide inzwischen gelernt haben, dass es nur ein Miteinander geben kann?
Über die verpasste Chance der Palästinenser in Camp David vor zwei Jahren, die ausgestreckte Hand der Israelis zu ergreifen, ist viel diskutiert worden. Wir wissen nicht, ob das Angebot von Ehud Barak, mehr als 90 Prozent der palästinensischen Gebiete zurückzugeben und auf die israelische Hoheit über ganz Jerusalem zu verzichten, letztlich glaubwürdig war und im eigenen Lande durchzusetzen gewesen wäre. Sicher ist nur, dass kein Ministerpräsident in der Geschichte Israels den Palästinensern ein größeres Angebot gemacht hat als Ehud Barak, und Palästinenserpräsident Arafat das Angebot weder ernsthaft geprüft, noch einen eigenen Vorschlag unterbreitet hat. Seit dem Scheitern von Camp David schien es, als sei die palästinensische Seite wieder zu ihrer alten Devise des „Alles oder Nichts“ zurückgekehrt, die sich für die Palästinenser in der Geschichte doch immer als die schlechteste Lösung erwiesen hat.
Nach der Verleihung des Friedensnobelpreises an die Unterzeichner des Oslo-Friedensabkommens Yitzhak Rabin, Shimon Peres und Jassir Arafat 1995 hoffte die man, Arafat werde sich vom „Befreiungskämpfer“ zum „Staatsmann“ wandeln und seinem Volk im Interesse des Friedens und einer nationalen Perspektive an der Seite Israels schmerzhafte Kompromisse abverlangen. Diese Hoffnung war verfrüht – stattdessen wählte die palästinensische Führung mit der Al-Aqsa-Intifada erneut den Weg des Terrors. Tatsächlich hat Arafat trotz Oslo in der Öffentlichkeit nie seine Uniform abgelegt. Als Auslöser dafür wird gemeinhin der Besuch von Ariel Sharon auf dem Tempelberg angesehen. Politische Analysen sprechen allerdings davon, dass der Rückzug der israelischen Armee aus dem Libanon die Palästinenser ermutigt haben könnte, zur Durchsetzung ihrer Ziele wieder auf das Mittel des Terrors zu setzen und damit die israelische Besatzung ein für alle mal zu beenden.
Inwieweit Arafat den Terror von Hamas, Dschihad und Al-Aqsa-Brigaden heute unterstützt, toleriert oder ob er einfach nicht mehr Herr der Lage ist, darüber existieren unterschiedliche Theorien. Die israelische Regierung legt Beweise vor, nach denen die Palästinensische Autonomiebehörde und Arafat selbst in Waffenkäufe und Terrormaßnahmen verstrickt seien. Sie moniert – wohl zu Recht – dass dieser gegenüber der westlichen Welt und im eigenen arabischen Lager mit gespaltener Zunge spreche. Der Eindruck bleibt, dass Jassir Arafat lieber als „Freiheitskämpfer“ und „Shahid“ (Märtyrer) in die Geschichte seines Volkes eingehen als ernsthaft versuchen will, den Irrsinn der Selbstmordattentäter zu stoppen. Wie es der eigenen Bevölkerung dabei geht, die unsäglich unter den Folgen leidet, scheint dabei nachrangig, wenn nicht gar förderlich, kann er doch jede Verantwortung für die miserable wirtschaftliche und soziale Lage in den Autonomiegebieten allein den israelischen Besatzern anlasten. Die Forderung nach einem Palästinenserstaat ist noch keine Leistung an sich. Die eigentliche Herausforderung besteht für die Palästinenser m.E. darin, mit dem Aufbau einer demokratischen Zivilgesellschaft in den Autonomiegebieten die Grundlage dafür zu schaffen, dass dieser von der israelischen Regierung und Bevölkerung auch akzeptiert werden kann. Hier geben die Ankündigungen des Palästinenserpräsidents zur baldigen Durchführung demokratischer Wahlen und zur Schaffung demokratischer Strukturen immerhin Anlass zu Hoffnung. Die Geschichte der jüdischen Gemeinschaft (Jischuw) in der britischen Mandatszeit in Palästina bietet hier reichlich Anschauungsmaterial.
Die israelische Bevölkerung war laut Umfragen schon lange vor Camp David mehrheitlich bereit, einen Palästinenserstaat an ihrer Seite zu akzeptieren und auf den größten Teil der Siedlungen zu verzichten bzw. einen Gebietsaustausch vorzunehmen – so auch Teil des Angebots von Ehud Barak in Camp David und später in Taba, wo man einer Lösung näher als je zuvor war. Heute kennzeichnen Angst, Verzweiflung und Irrationalität den Alltag der Israelis. Jeder, der sein Haus verlässt, muß befürchten, von einem Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt zu werden. Eltern bangen vor allem um ihre Kinder. Der terroristische Alltag spielt sich nicht – wie früher – in der Westbank, in Gaza oder in Jerusalem ab, sondern im Herzen Israels: Jeder kann der nächste sein.
Viele Israelis sehen das Vorgehen der Regierung Sharon, an der neben der Arbeitspartei auch verschiedene kleinere Parteien unterschiedlicher Provenienz beteiligt sind, mit Sorge und Unbehagen, doch nur wenige sehen eine Alternative, denn: Welche Regierung würde sich nicht mit aller Kraft wehren, wenn die eigenen Bürgerinnen und Bürger fast täglich auf grausamste Weise zu Tode kommen, Im Angesicht der Bedrohung – so war es schon zu früheren Zeiten – steht die Mehrheit der Israelis, welcher Couleur auch immer, fest zusammen. Auf Kritik von außen – vor allem aus Ländern, die den Holocaust nicht zu verhindern wußten – wird häufig mit Trotz und der stets neuen Erkenntnis reagiert: „Wir können uns auf niemanden als uns selbst verlassen“.
Doch halt – es gibt sie ja , die wackeren Friedenskämpfer, allen voran Uri Avnery mit seinem Gush Shalom, aber auch Peace Now und die zahlreichen kleineren Initiativen im Lande, die unbeirrt an ihrer Vision eines friedlichen Zusammenlebens von Israelis und Palästinensern festhalten. Aufsehen erregten Anfang des Jahres ca. 300 Reserveoffiziere, die sich weigerten, in den besetzten Gebieten Dienst zu tun und dafür eine mehrtägige Inhaftierung in Kauf nahmen – ein Phänomen, das erstmals im Libanon-Krieg 1982 zu beobachten war, als der damalige Oberbefehlshaber der israelischen Armee, General Sharon, das Massaker christlicher Falangisten in dem palästinensischen Flüchtlingslager Sabra und Shatila nicht verhinderte und im Anschluss Hunderttausende von Israelis gegen ihn auf die Straße gingen. Eine staatlich einberufene Untersuchungskommission bestätigte damals eine Verantwortung Sharons;, die eigentlichen Mörder aber – libanesische „christliche“ Falangisten – blieben bis heute unbelangt. Israels Staatspräsident Moshe Katzav machte vor Monaten mit einem Vorschlag von sich reden, der ebenfalls bemerkenswert ist. Er wollte nach Ramallah fahren, um die Palästinenser vom Friedenswillen des israelischen Volkes zu überzeugen. Eine mutige Geste, die Ministerpräsident Sharon allerdings zu verhindern wußte. Wie schade.
Die Bereitschaft zu Kompromissen ist in Israel rapide gesunken. Von den Verweigerungsreservisten hört man heute kaum noch etwas und auch der Sprecher von „Peace Now“, Didi Remez, eilte an die Front, nachdem sein Dienstherr ihn gerufen hatte. Der Glaube an ein friedliches Miteinander könnte m.E. nur dann wieder wachsen, wenn auch auf palästinensischer Seite deutliche Zeichen für eine Friedensbereitschaft auszumachen wären. Der langjährige israelische Friedensaktivist Willy Gafni brachte es vor einigen Jahren auf den Punkt: als Anwar Al-Sadat 1977 nach Jerusalem kam und damit erstmals ein arabisches Land die Existenzberechtigung Israels anerkannt hatte, so Gafni, wäre er von den Israelis mit überwältigender Mehrheit zum neuen Ministerpräsidenten gewählt worden. Der Vorschlag des saudischen Kronprinzen, die arabischen Staaten seien bereit, die Existenz Israels in der Region anzuerkennen, wenn Israel die palästinensischen Gebiete vollständig räume, ließ hier neue Hoffnung aufkeimen. Die Prüfung der Ernsthaftigkeit dieses Angebots steht aber noch aus.
Und wo sind die ernst zu nehmenden Partner auf palästinensischer Seite? Wo die kleinen Gesten, die in der israelischen Öffentlichkeit so vieles bewirken könnten? Wo hört man klar und deutlich vernehmbare Stimmen gegen die tägliche Hasspropaganda und Agitation gegen Israel in den arabischen Medien, in den Moscheen, auf Plakaten und Pamphleten? Stattdessen liest man, dass Hitlers „Mein Kampf“ und die unsäglichen „Protokolle der Weisen von Zion“ in der Region immer noch zu Bestsellern gehören und die palästinensischen Kinder ihr Israelbild nach wie vor aus jordanischen und ägyptischen Schulbüchern gewinnen. Auch die mit internationaler Unterstützung erarbeiteten neuen Schulbücher für die 6. Klasse zeigen Israel nicht als geographische und politische Realität in der Region, sondern blenden den Judenstaat einfach aus. Wer äußert sich deutlich gegen die Instrumentalisierung und den Missbrauch von Kindern und Jugendlichen für den Kampf gegen Israel? Und wo regt sich Widerstand gegen die Ausbildungslager für künftige Selbstmordattentäter, in denen den „Märtyrern“ um so paradiesischere Zustände versprochen werden, je mehr Juden sie mit in den Tod reißen?
Israel sieht sich heute wie bei der Staatsgründung und im Sechstage-Krieg wieder in einem Überlebenskampf – eine schlechte Voraussetzung, um Empathie und Mitgefühl für die Leiden des palästinensischen Volkes zu entwickeln. Die Anerkennung palästinensischer Forderungen in Camp David nach einem Rückkehrrecht von 3,5 bis 4 Mio. palästinensischen Flüchtlingen (und ihren Nachkommen) kommt aus Sicht der meisten Israelis einem Todesurteil gleich, leben doch in ganz Israel nur ca. 5 Mio. Juden, dazu kommen heute schon etwa 1,2 Mio Araber. Die erwartete demographische Entwicklung in den nächsten Jahren würde das Ende des Judenstaates bedeuten, der doch gerade vor dem Hintergrund des immer wieder aufflammenden Antisemitismus in aller Welt für Juden Zufluchtsstätte bleiben soll. Sicher, nicht alle Flüchtlinge würden kommen, doch die Angst bleibt. In der „Zeit“ konnten wir vor einigen Wochen bei Josef Joffe lesen, dass der palästinensische Psychiater Eyad Sarraj als Motiv der Selbstmordattentäter nicht etwa ihren Wunsch nach Befreiung der Gebiete und einem eigenen Staat benannt hat, sondern die Sehnsucht der Araber nach „Rache“, nach Beseitigung der „Schande“, die 1948 zusammen mit dem Staat Israel geboren wurde. Wer aber in der staatlichen Existenz des anderen die Ursache für das eigene Elend sieht, der kann erst ruhen, wenn der andere vernichtet ist. Die meisten Israelis glauben heute, Arafat habe mit der Unterzeichnung der Oslo-Verträge nur einen anderen Weg gewählt, um Israel letztlich doch noch zu „liquidieren“, so Colette Avital, Knesset-Abgeordnete und Mitglied der Arbeitspartei kürzlich bei einem Deutschlandbesuch. Dazu paßt das Interview mit Benny Morris, der als einer der sog. „Neuen Historiker“ in Israel Mitte der 80er Jahre zu den ersten gehörte, die israelische Gründungsmythen in Frage gestellt und nachgewiesen hatte, dass den Palästinensern bei Staatsgründung u.a. durch gezielte Vertreibungen Unrecht geschehen war. Er lehrt heute Geschichte an der Ben-Gurion-Universität in Beersheva. In der israelischen Tageszeitung „Yediot Acharonot“ erklärte er am 23. November 2001: „Im Herzen eines jeden Palästinensers besteht der Wunsch, der Staat Israel möge nicht mehr sein. Für viele von ihnen wird daraus mehr als ein Wunsch. Sie glauben, dass all ihr Unglück eine Folge unserer Taten ist und dass unsere Zerstörung ihre Erlösung bringen wird. Ihre Lösung ist Palästina als Ganzes“. An anderer Stelle beklagt er nicht nur die anti-israelische Propaganda der Palästinenser, sondern auch die Tatsache, dass bis heute kein Palästinenser auch den Zionismus als nationale Befreiungsbewegung anerkannt habe.
Das Schlimme ist, wir wissen nicht, ob Eyad Sarraj und Benny Morris recht haben, zumindest hören wir keine gewichtige palästinensische Stimme, die uns überzeugen könnte, dass sie irren. Und deshalb gilt: Im Zweifel müssen wir Deutschen an der Seite Israels stehen. Das schließt nicht aus, dass wir im Interesse einer Zukunftsperspektive für beide Völker in der Region die Friedenskräfte überall unterstützen sollten, und seien sie noch so wenige. Dabei wünsche ich mir, dass auch die Medien mehr über Friedensinitiativen und Einzelbeispiele eines friedlichen Miteinanders berichten, die beweisen, dass eine Verständigung von Israelis und Palästinensern möglich ist. Nur dann können jahrelang verfestigte Feindbilder abgebaut werden.
Die EU sollte künftig mehr tun, um von der Palästinensischen Autonomiebehörde – mit Geld und Know how, aber notfalls auch mit Sanktionen – den Aufbau demokratischer Strukturen zu fordern. Auf jeden Fall muß sie verhindern, dass ihr – und damit auch das Geld deutscher Steuerzahler – für Waffen und Propaganda gegen Israel eingesetzt wird – eine perfide Vorstellung nach dem Holocaust. Hoffen wir, dass die angestrebte Nahost-Friedenskonferenz hier neue Impulse geben kann. Als Zeichen der Hoffnung werte ich auch den jüngst veröffentlichten Appell von 55 palästinenischen Intellektuellen und Politikern gegen den Irrsinn der Selbstmordattentate.