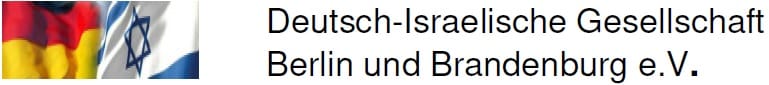Ihr Büro ist noch kahl, die Wände sind blassgelb gestrichen. Kleinigkeiten, über die Ulrike Trautwein lacht. Überhaupt ist die neue Generalsuperintendentin eine personalisierte Charmeoffensive der evangelischen Kirche.Interview: Marie-Claude Bianco / Claudius Prösser
taz: Frau Trautwein, wir stellen uns jetzt mal ganz dumm: Was ist das überhaupt, eine Generalsuperintendentin?
Ulrike Trautwein: Ich habe auch eine Weile gebraucht, um das herauszufinden. (lacht) In erster Linie ist dieses Amt eine Art geistliche Leitung für Berlin. Ich bin hier in der Stadt die Vertreterin von Landesbischof Markus Dröge, neben mir gibt es zwei weitere Generalsuperintendenten, eine für Brandenburg und einen für die schlesische Oberlausitz. Ich nehme die Anliegen der Berliner Pfarrer und Kirchenkreise auf und bringe sie in die Kirchenleitung ein, bin aber auch ein Gegenüber für Politik und Kultur. Ich stehe relativ weit außerhalb der Hierarchien. In der Schwerpunktsetzung meiner Arbeit bedeutet das eine gewisse Freiheit.
Hat es einen Grund, dass Sie hier in Wilmersdorf sitzen und Bischof Dröge im Osten?
Die Frau: Ulrike Trautwein wird 1958 in Limburg an der Lahn geboren und wächst in Frankfurt/Main auf. Nach dem Abitur studiert sie evangelische Theologie in Mainz und Marburg. Sie ist mit dem Pfarrer Reinhold Truß-Trautwein verheiratet und hat eine Tochter.
Der Weg: Ihr Vikariat in Gießen ergänzt sie mit einem Spezialvikariat an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät Erlangen. 1987 wird Trautwein Pfarrerin der Gemeinde Laubach in Oberhessen. Parallel dazu arbeitet sie ab 1989 für den Hessischen Rundfunk, als Autorin für Verkündigungssendungen. 1998 wechselt sie in die Kirchengemeinde Frankfurt-Bockenheim. Seit 2003 gehört sie der Synode der Evangelischen Kirche Deutschland an.
Der Name: Ihr Vater war der Frankfurter Propst und Liederdichter Dieter Trautwein (1928-2002), von dem unter anderem das bekannte Kirchenlied „Komm, Herr, segne uns“ stammt.
Das Amt: Seit dem 1. Dezember 2011 ist Ulrike Trautwein die Berliner Generalsuperintendentin der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) und damit Regionalbischöfin von 695.000 Protestanten.
Mein Büro ist hier, weil die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche meine Predigtstelle ist. Hier predige ich einmal im Monat. Aber natürlich bin ich für ganz Berlin zuständig – und sogar für einige Gemeinden darüber hinaus.
Das Amt war vakant, seit Ihr Vorgänger Ralf Meister als Landesbischof nach Hannover gegangen ist. Haben Sie einfach eine Initiativbewerbung geschickt?
Nein, ich bekam eines Morgens einen Anruf von Bischof Dröge. Das Wahlgremium der Landeskirche wollte mich zu einem Gespräch einladen. Ich selbst wäre nicht im Leben auf die Idee gekommen! Schließlich wurde ich mit zwei Mitbewerbern nominiert und habe in kurzer Zeit ein Bewerbungsverfahren durchlaufen. Nebenher musste ich die Predigt für den Abschlussgottesdienst des Dresdener Kirchentags vorbereiten. Das war eine sehr spannende Zeit.
Die Berliner Synode, also das Kirchenparlament, entschied sich dann erst im fünften Wahlgang für Sie. Ist doch komisch: Erst wird man gefragt und dann gibts einen Wahlkrimi.
Nein, wieso? Das spricht doch in erster Linie dafür, dass auch die anderen beiden gute Bewerber waren. Und außerdem: Jetzt bin ich gewählt, wen interessiert das noch in zehn Jahren? (lacht)
Wie empfinden Sie Berlin: Fühlen Sie sich nach vielen Jahren in Frankfurt am Main ein bisschen überrumpelt von den Brüchen dieser Stadt?
Das ist doch genau das, was ich liebe. Die Spannung, die entsteht, wenn so viele Menschen aufeinandertreffen, kann ja auch gute Energie erzeugen. Ich war vor zwei Jahren mit einer israelischen Freundin hier. Ihre Tochter ist Punklesbe und Veganerin, sie lebt in einem linken Hausprojekt in Friedrichshain und verkauft auf dem Flohmarkt Gürtel aus Fahrradschläuchen. In diesem Hausprojekt haben wir auch übernachtet und an einem Freitagabend ein rudimentäres Schabbatmahl gefeiert, diese uralte Tradition der Befreiung. Das Zusammenkommen so unterschiedlicher Dinge fand ich sehr anrührend, und dieses Bild verbinde ich mit Berlin.
Sie haben einen engen Bezug zum Judentum, ist oft zu lesen. Wie kam es dazu?
Meine Eltern waren eng mit Oskar Schindler befreundet, der ja bis zu seinem Tod in Frankfurt lebte. Über eine Freundin von Schindler, Hansi Brand, eine ungarische Jüdin, bin ich nach dem Abitur für ein Jahr nach Israel gegangen. Sie war Hausmutter in einem Kinderheim in Tel Aviv, und ich arbeitete dort als Volontärin. Dabei habe ich Ivrit so schnell gelernt wie sonst keine andere Sprache mehr. Ich war ja umgeben von 120 Jungs zwischen 6 und 16, die keine andere Sprache sprachen. Auch meine Kindheitsfreundin, mit der ich seit der 5. Klasse ganz eng zusammen bin, ist Jüdin. Sie lebt jetzt aber schon lange in New York.
Lassen Sie uns über Ihre Eltern sprechen. Ihr Vater, Dieter Trautwein, war auch Theologe und ein bedeutender Komponist evangelischer Kirchenlieder. Stört es Sie eigentlich, immer auf Ihn angesprochen zu werden?
Nein, gar nicht. Als ich vor 25 Jahren geheiratet habe, hätte ich ja den Familiennamen aufgeben können, wenn ich Schwierigkeiten damit gehabt hätte. Stattdessen hat jetzt mein Mann, der Arme, einen Doppelnamen. Für mich ist es ein wichtiger Bestandteil meiner selbst, aus dieser Familie zu kommen. Ich hatte eine sehr kämpferische Mutter, die sich in der Anti-Apartheid-Bewegung engagiert hat. Sie war dann auch die erste deutsche Staatsbürgerin, die ein Einreiseverbot für Südafrika erhielt. Uns Kindern ging das auch schon mal auf den Keks. Aber ich glaube, ich habe von beiden Eltern das Engagement geerbt.
Was hieß Engagement für Ihren Vater?
Nach seiner Anfangszeit als Pfarrer in Limburg, wo ich geboren bin, wurde er 1963 Stadtjugendpfarrer in Frankfurt am Main. Sein Schwerpunkt war damals, neue Gottesdienstformen zu entwickeln. In den 70ern wurde er dann Propst, das war eine politisch sehr aufgewühlte Zeit. Wir wohnten am Römerberg in der Frankfurter Innenstadt und haben dort sehr viele Demonstrationen hautnah mitbekommen. Für mich war immer klar: Christlicher Glaube ist eng verbunden mit gesellschaftlichem Engagement. Das eine geht ohne das andere nicht.
Würden Sie sich politisch links einordnen?
Ich würde mich nie parteipolitisch engagieren, schon gar nicht in meinem Amt. Da wird man dann in Schubladen gepackt, und das möchte ich nicht. Zumal es immer wieder Fragen gibt, bei denen sich ganz erstaunliche Koalitionen bilden.
Ihr Vater hat einen modernen Klang und eine neue Sprache in die Kirche gebracht. Heute scheint die Entwicklung in die umgekehrte Richtung zu zeigen: Kirchenmitglieder, auch jüngere, sind auf der Suche nach traditionellen Formen.
Damals galt es, alte Formen aufzubrechen, die teilweise auch mit repressiven Inhalten verbunden waren. Dass es heute eine andere Bewegung gibt, wo Leute eher Heimat suchen und nicht jeden Sonntag etwas anderes erleben wollen, finde ich verständlich. Trotzdem denke ich, dass wir bei der Sprache zeitgenössisch bleiben müssen – ohne theologische Leerformeln oder Worthülsen zu verwenden. Für mich ist das immer wieder eine Herausforderung, beim Predigtschreiben. Man sagt mir im Übrigen nach, dass ich beim Predigen nach meinem Vater komme.
Auch bei der Musik?
Ich singe schrecklich gerne, aber ich käme nicht auf die Idee, Lieder zu dichten. Das ist nicht so meins. Als Kinder hatten wir jedenfalls großen Spaß mit meinem Vater, manchmal hat er Sachen mit uns ausprobiert. Und wenn wir auf langen Autofahrten zu sehr randaliert haben, gab er die Devise „Harmonia Trautonia“ aus. Das bedeutete, wir durften singen und kreischen, was wir wollten – bis wieder Frieden auf der Rückbank herrschte.
Berlin ist alles andere als eine fromme Stadt, auch viele evangelische Gemeinden schrumpfen. Wie gehen Sie mit den vielen Austritten um?
Das Austreten ist gar nicht so sehr unser Thema, sondern mehr die Generationenveränderung. Die großen Generationen alter Menschen sterben, und es kommen nicht so viele nach. Aber diese Dinge machen mir keine Angst. Was ich mir wünsche, ist, in der Gesellschaft präsent zu bleiben. Ich will, dass unsere Türen offen sind und sich Menschen dafür interessieren.
Wie war das in Frankfurt?
In unserer Gemeinde gab es sogar ein leichtes Plus. Ich habe getauft wie ein Weltmeister. (lacht)
Ein Thema, mit dem Sie sich noch öfter auseinandersetzen werden müssen, ist der Religionsunterricht an staatlichen Schulen. Kürzlich haben Sie gesagt, es sei „bitter, dass das Kennenlernen des christlichen Glaubens nur außerhalb der normalen Unterrichtszeit geht“. Mit Verlaub, aber aus der Perspektive vieler Berliner ist das ganz normal. Hier fragt man sich eher, ob es das Problem des Staates ist, wenn Kirche und Familie es alleine nicht schaffen, den Glauben weiterzugeben.
Sie spielen auf „Pro Reli“ an. Ich bin noch dabei, dieses Thema in seiner ganzen Tiefe zu ermessen. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen: Religion ist ein gutes und wichtiges Fach. Als reguläres Unterrichtsfach wie in Hessen und den meisten anderen Bundesländern halte ich es für eine große Bereicherung. Ich muss mich jetzt damit auseinandersetzen, dass es hier nicht so ist. Natürlich bedauere ich das, als Frau der Kirche.
Die Idee des verpflichtenden Ethikunterrichts ist doch, junge Menschen in einer Multikulti-Stadt nicht zu separieren, sondern zusammenzubringen.
Das leuchtet mir schon ein. Ich habe ja etwas ganz Ähnliches an meiner Schule gemacht. Aber ich glaube, es ist etwas anderes, ob ich das Thema von innen her erschließen kann oder nur über Religion spreche.
Sie haben auch als Lehrerin gearbeitet?
Ja, als Pfarrerin in Frankfurt-Bockenheim habe ich an einer Hauptschule unterrichtet. Diese Schule besuchen fast nur muslimische Schüler und Schülerinnen, und bevor ich dort anfing, hatte es jahrelang keinen Religionsunterricht gegeben. Wir haben überlegt, wie wir mit dieser Situation umgehen, und am Ende beschlossen, dass ich gesamte Klassen unterrichte, nicht nur die evangelischen Schüler, die es vereinzelt auch gab. Das lief natürlich nicht unter „Evangelische Religion“. Es ging im Unterricht oft um ganz elementare Dinge wie Gefühle. Wir haben Fantasiereisen gemacht, Körperarbeit. Aber gerade nach dem 11. September 2001 wurde es auch wichtig, mit den Älteren viel über Religion zu reden.
Das ging konfliktfrei ab?
Nein. Womit ich sehr zu kämpfen hatte, war der wahnwitzige Antisemitismus, der unter den Schülern herrschte. Einerseits wollte ich die Jugendlichen nicht stigmatisieren, auf der anderen Seite das Thema aufarbeiten. In einer Gruppe habe ich wirklich irgendwann das Klassenbuch auf den Tisch gepfeffert und gesagt: „Tut mir leid, aber ich unterrichte euch nicht mehr.“ Das war während des Libanonkrieges, ich hatte von einem jungen israelischen Soldaten erzählt, den das in große Konflikte brachte. Worauf einige durch den Raum brüllten: „Wers glaubt, wird selig!“
Und Sie haben diese Klasse nicht mehr unterrichtet?
Es war in der Tat das einzige Mal, dass ich aufgegeben habe, und ich weiß immer noch nicht, ob das richtig war. Aber wir hatten sehr lange daran gearbeitet, dass jeder Mensch anders ist. Dass nicht alle Muslime oder Juden oder Christen „so“ oder anders sind. Und dann diese Reaktion.
Aber Antisemitismus ist kein rein muslimisches Problem.
Natürlich nicht. In einer Predigt in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche habe ich erst vor kurzem gesagt, wie sehr es mich schockiert, dass antisemitische Einstellungen bei Mitgliedern christlicher Kirchen noch etwas höher sind als allgemein in der Bevölkerung. Ich habe zu dieser Predigt viel Zustimmung bekommen, aber es gab auch vereinzelte Reaktionen nach dem Motto: Da wollten wir ein bisschen Ruhe und etwas Schönes hören, und jetzt sind wir aufgeregt und aufgewühlt!
Wenn man an Martin Luthers Antijudaismus denkt, hat die evangelische Kirche ja auch großen Nachholbedarf.
Die Aufarbeitung des Antijudaismus innerhalb der christlichen Tradition ist für mich ein ganz wichtiges Thema, dem wir uns noch intensiver stellen müssen. Obwohl wir da theologisch schon lange dran sind. Die Frage lautet aber: Wie kriegen wir das in die Herzen und die Köpfe der Menschen? Trotzdem, antisemitische oder auch antiislamische Einstellungen sind ein Problem der ganzen Gesellschaft, nicht nur der Religion. Gerade in diesen unsicheren Zeiten, die ein ganz hohes Differenzierungsvermögen erfordern, hält man sich gerne an Feindbildern fest.
Was auch durch die rechtsextreme Mordserie wieder ins Bewusstsein geraten ist. Hat Sie das eigentlich überrascht?
Ja und nein. Dass diese Anschauungen da sind, das weiß man. Was mich schockiert hat, ist das politische Unvermögen. Dass man diesen Menschen nicht auf die Spur gekommen ist. In Frankfurt am Main kann man diese Realität schon manchmal vergessen. Wir haben dort keinen ausgewiesenen Rechtsextremismus, es ist eine sehr weltoffene Stadt. Für diese Landschaft hier muss ich diese Dinge noch neu erkunden.
Wie haben Sie sich von Frankfurt verabschiedet?
Ich habe dort noch einmal mit der Familie Weihnachten verbracht. Eigentlich hätte ich hier predigen müssen, aber als meine Kollegen mitbekamen, dass ich es an dem Tag nicht mehr nach Frankfurt geschafft hätte, haben sie gesagt: „Du darfst fahren.“ Mein Mann ist ja noch Pfarrer in Bockenheim, und bis unsere Tochter im Sommer schriftliches Abitur macht, bleibt er in der Gemeinde. Also habe ich in Frankfurt Heiligabend gefeiert – nach einer halben Ewigkeit zum ersten Mal, ohne selbst einen Gottesdienst zu halten. Für meine Tochter war das etwas ganz Besonderes. Sie hat schon oft gesagt: „Ich glaube, ich bin das einzige Kind, das Heiligabend ganz alleine ist!“ (lacht)